VL 11 REAPEAT
1/47
There's no tags or description
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |
|---|
No study sessions yet.
48 Terms
Phonetik/Phonologie
Wichtig: Was ist der Unterschied zwischen Phonetik und
Phonologie? Womit besch¨ aftigen sich die beiden
Disziplinen?
Die Phonologie untersucht die Rolle der Laute im
Sprachsystem im Hinblick auf ihre
bedeutungsunterscheidende Funktion.
Die Phonetik untersucht die messbaren physiologischen
und physikalischen Eigenschaften der Laute.
Lautklassifikation
Laute werden nach ihrer Bildungsweise klassifiziert
nach Artikulationsart (Art der Konstriktion: Plosiv, Nasal,
Reibelaute (Frikative), Vibranten (Trill), Schlaglaut (tap
oder flap), Approximant)
nach Artikulator
aktive Artikulatoren
passive Artikulatoren
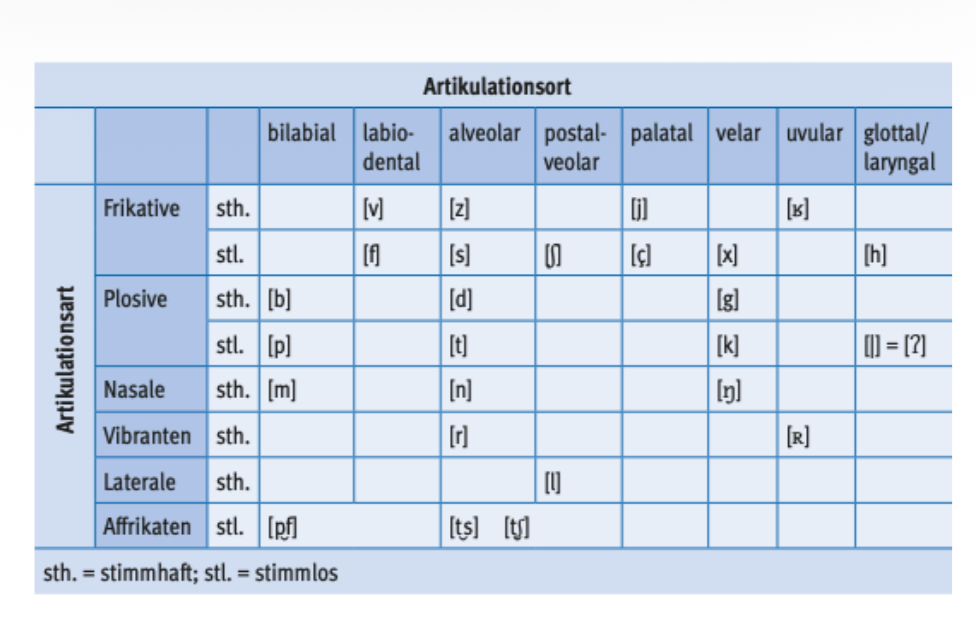
Konsonanten
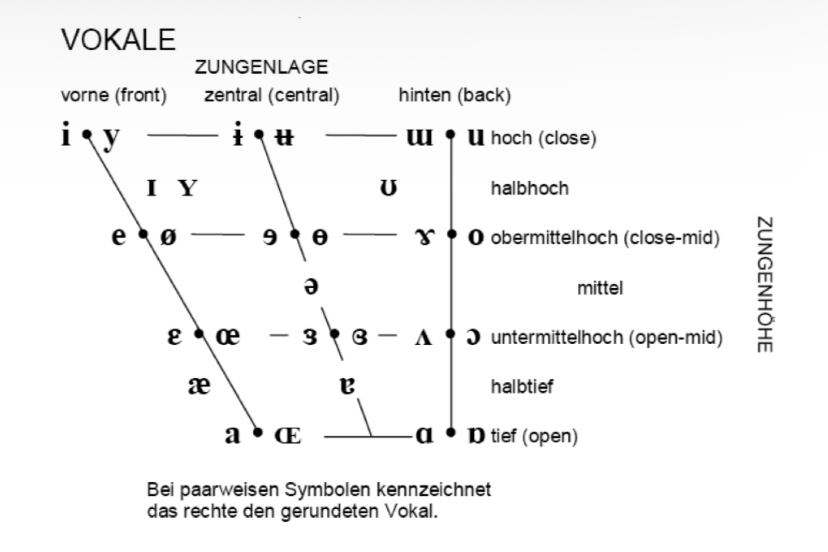
Vokaltrapez
Phonetische Symbole
Zur einheitlichen Repr¨ asentation von Lauten wurde das
internationale phonetische Alphabet (IPA) entwickelt, das
auf alle Sprachen anwendbar ist
Laute (genauer: Phone) werden in eckigen Klammern
dargestellt, Phoneme in Schr¨ agstrichen.
Phon = kleinste im Sprachschall (Lautkontinuum)
unterscheidbare Einheit
Phonem = kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit
der Sprache
Phonologische Prozesse
Die Phonologie besch¨ aftigt sich weiterhin mit Prozessen,
die an der (verschiedenartigen) Realisierung von Lauten
beteiligt sind: Phonologische Prozesse
Tilgung von Segmenten (Apokope, Synkope)
Hinzuf¨ ugen von Segmenten (Epenthese)
kontextuell lizensierte Ver¨ anderung von Segmenten
(Assimilation, Dissimilation)
Umstellung von Segmenten (Metathese)
Wichtig! Auslautverhärtung
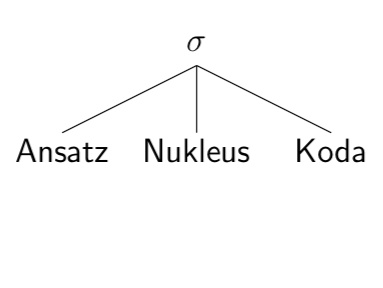
Konstituenten der Silbe
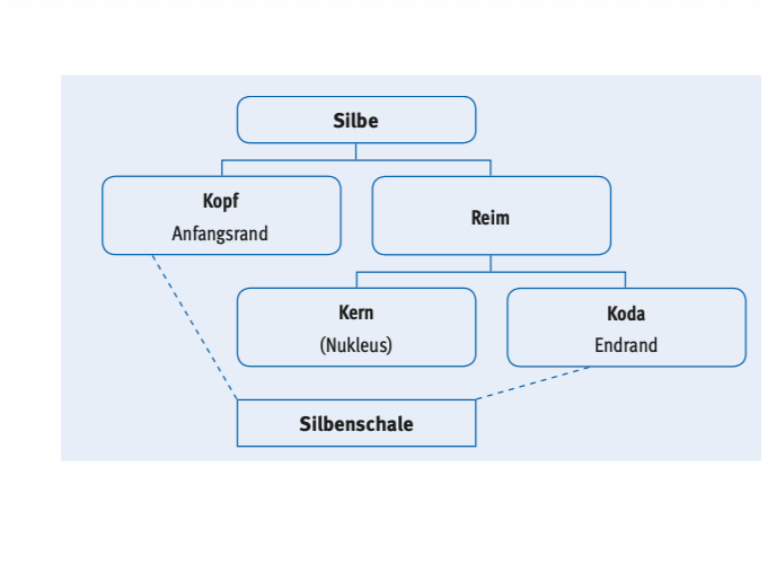
Silbenstruktur
Graphematik vs Orthographie
Graphematik: Schriftsystem mit eigenen, sich spontan
innerhalb einer Sprachgemeinschaft herausgebildeten
Regularit¨ aten.
Orthographie: “richtiges Schreiben”; durch Institution
normierte Schrift, in amtlichen Regelwerken festgelegt.
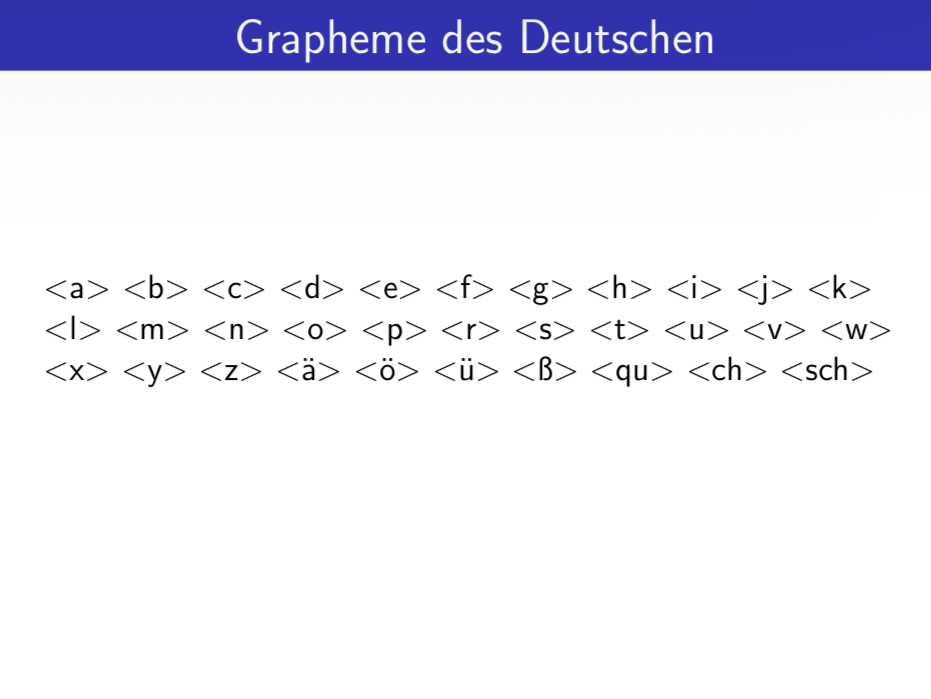
Graph und Graphem
In der Graphematik findet sich ein paralleles Verh¨ altnis,
das wir in der Phonologie/Phonetik zwischen Phon und
Phonem gesehen haben.
Im Prinzip entspricht ein Graph einem Buchstaben.
Was ist dann ein Graphem?
So wie Phoneme die kleinste bedeutungsunterscheidende
Einheit der Lautsprache sind, sind Grapheme also die
kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten
der Schriftsprache.
Sie werden in spitzen Klammern dargestellt: <a>, <f>,
<sch>, <ch>, <p>, <x>, ...
Schreibprinzipien
Das Wesen der Alphabetschrift ist, dass die Schrift die
Lautung anzeigt (phonographisches Prinzip).
Diesem Prinzip stehen allerdings andere Prinzipien
entgegen, was ggf. zu Konflikten f¨ uhrt:
Verwandte W¨ orter sollen m¨ oglichst ¨ ahnlich geschrieben
werden (morphologisches Prinzip).
Wenn m¨ oglich soll die Wortherkunft erkennbar bleiben
(etymologisches Prinzip).
Das System soll trotz dieser konfligierenden Prinzipien
insgesamt m¨ oglichst einheitlich bleiben (¨ asthetisches
Prinzip).
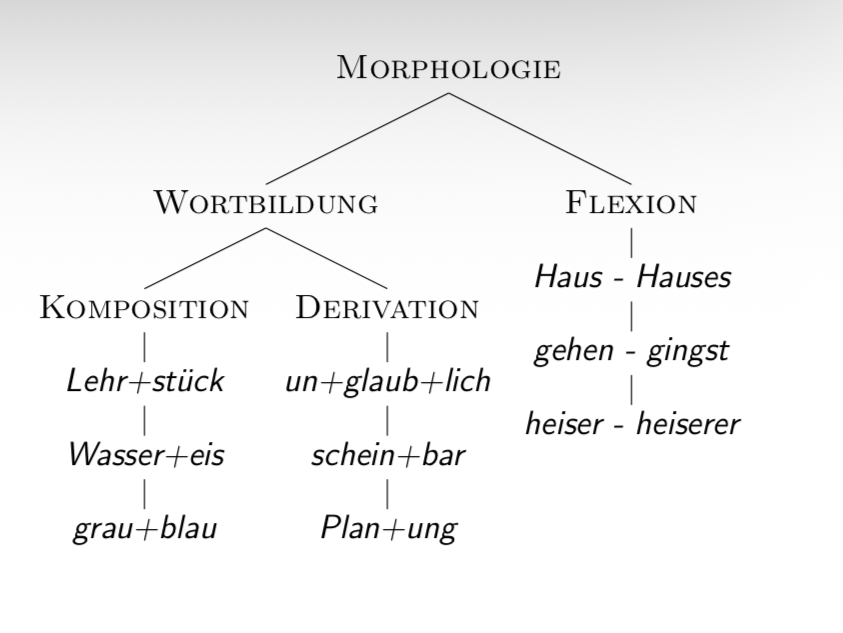
Teilgebiete der Morphologie
Morphem
Morphem = die kleinste, in ihren verschiedenen
Vorkommen als formal einheitlich identifizierbare Folge
von Segmenten [≈Einzellauten], der (wenigstens) eine als
einheitlich identifizierbare außerphonologische Eigenschaft
zugeordnet ist.
Allomorph: kleinste realisierbare Einheiten mit derselben
semantischen und/oder grammatischen Funktion
Einteilung der Morpheme: Inhalts- vs.
Funktionsmorpheme, freie vs. gebundene Morpheme,
verschiedene funktionale Morpheme (Stamm-,
Derivations-, Flexionsmorpheme + Fugenelemente)
Morphologische Prozesse: Derivation, Komposition,
Flexion
Affixe
Affixe sind abh¨ angige Morpheme
Viele Affixe sind Derivationsmorpheme: Pr¨ afixe, Suffixe,
Zirkumfixe
Flexionsmorpheme sind auch Affixe im Deutschen
Dabei ein Morphem - mehrere Funktionen (fusionaler
deutscher Typ)
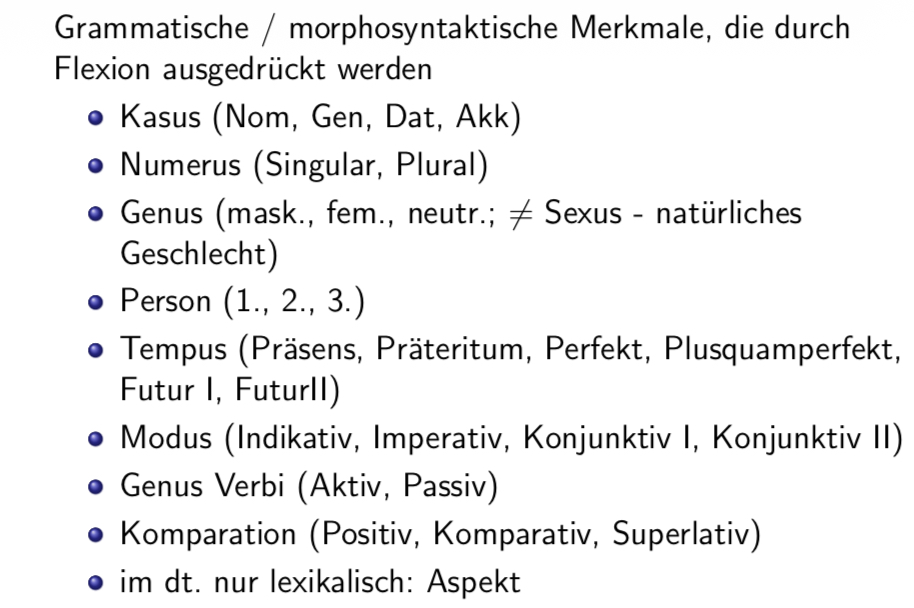
Verbalflexion
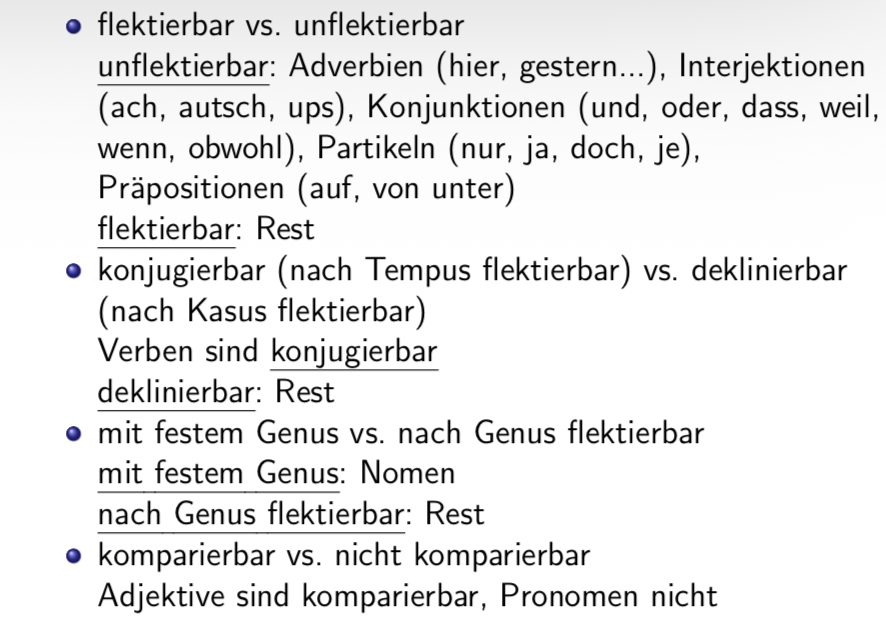
Klassifikation von Wortarten anhand von Flexion
Derivation
Derivation erfolgt durch Affigierung. Es entsteht ein neuer
Lexikoneintrag
Im Unterschied zur Flexion entsteht ein neues Lexem,
keine neue Wortform, im Unterschied zur Komposition:
Beteiligung von gebundenen, nicht-lexikalischen
Morphemen
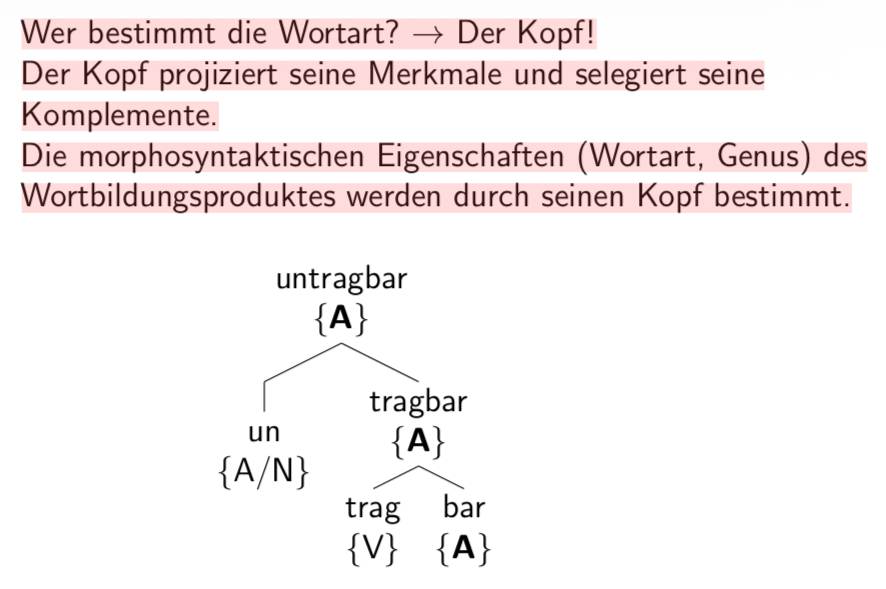
Kopf und Projektion der Wortstruktur
Wer bestimmt die Wortart? →Der Kopf!
Der Kopf projiziert seine Merkmale und selegiert seine
Komplemente.
Die morphosyntaktischen Eigenschaften (Wortart, Genus) des
Wortbildungsproduktes werden durch seinen Kopf bestimmt.
Komposition
Komposition = Wortbildung durch Kombination von
lexikalischen /(meist) freien Morphemen
Im Unterschied zur Flexion handelt es sich bei der
Komposition um einen Wortbildungsprozess (Flexion ist
Wortformbildung!)
Unterschied zur Derivation? keine Beteiligung von Affixen!
Verschiedene Kompositionstypen:
Determinativkompositum, Rektionskompositum,
Kopulativkompositum, Possessivkompositum
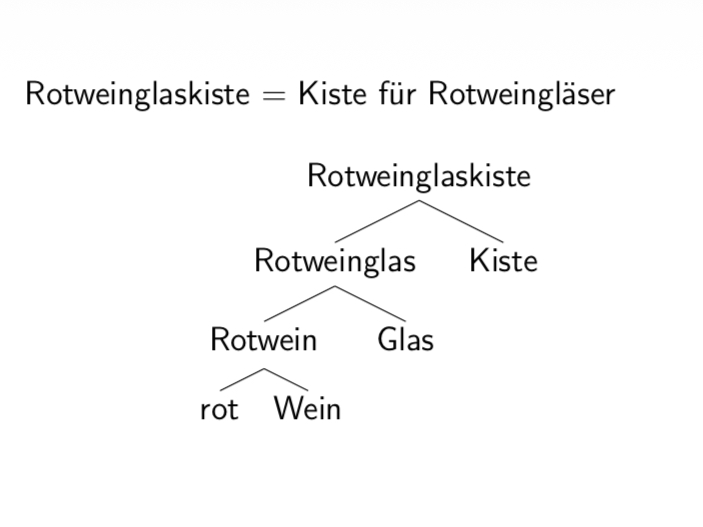
Strukturbäume
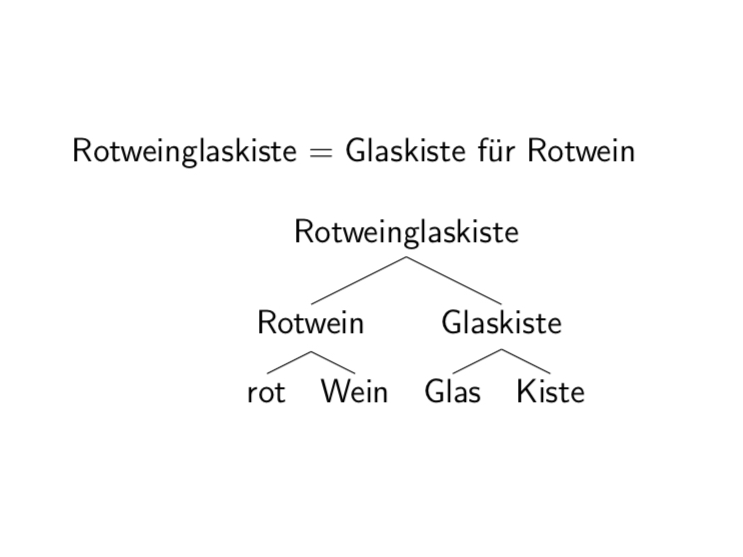
Strukturbäume
Begriffe
Kopf: Als Kopf wird der Teil eines Wortbildungsproduktes
bezeichnet, der die grammatischen Eigenschaften des
komplexen Wortes bestimmt.
Projektion: Projektion ist der Name f¨ ur das
Wortbildungsprodukt. Die Eigenschaften des Kopfes
werden auf das Ganze projiziert.
Kopfvererbungsprinzip: Die morphosyntaktischen
Eigenschaften des Wortes werden durch seinen Kopf
bestimmt.
Kopfparameter: Im Deutschen ist der Kopf (bei
Wortbildungen) immer rechts (Die sog.
Right-Hand-Head-Rule).
Kern: Das grundlegende Element bei Komposita.
S¨ atze und Konstituenten
Die Syntax besch¨ aftigt sich damit, wie einzelne Teile
(Morpheme) zu gr¨ oßeren Teilen (S¨ atzen)
zusammengef¨ ugt werden k¨ onnen und welche
zugrundeliegenden Regeln bestehen.
Mehrere zusammengeh¨ orende Teile bilden eine
Konstituente.
Eine Konstituente ist eine koh¨ arente Wortgruppe mit
syntaktischer Funktion und/oder Bedeutung. Einzelw¨ orter
sind ebenfalls Konstituenten.
Durch sog. Konstituententests k¨ onnen wir testen,
welche Teile eines Satzes zusammengeh¨
oren.
Ersetzung, Pronominalisierung, Weglassen, Fragen,
Koordination, Verschieben, Topikalisieren
Konstituentenklassifikation
Jedes Element ist einer Wortart zugeh¨ orig.
Jede Konstituente, die komplex ist, ist einem Kopf
zugeordnet. Dieser Kopf projiziert eine Phrase. Die
Kategorie entspricht dabei der Wortart des Kerns.
Beispiel: {Die Haustiere, Kinder, die langen
Winterabende}haben dieselbe Distribution.
Wortart der primitivsten Konstituente: Nomen.
Konstituenten mit derselben Distribution wie Nomen:
Nominalphrase.
Valenz
Einige Konstituenten binden andere Konstituenten an
sich. Sie brauchen andere Konstituenten, um im Satz
grammatikalisch richtig verwendet werden zu k¨
onnen. →Valenz
schlafen (intransitiv, einwertig) fordert ein Subjekt.
reparieren (transitiv, zweiwertig) fordert Subjekt und
Objekt.
Dasjenige Element, das eine Valenz fordert, wird als
Regens (regierendes Element) bezeichnet. Ein
abh¨ angiges Element wird als Dependens bezeichnet.
Obligatorische Konstituenten sind Argumente, solche,
die fakultativ ausgedr¨ uckt werden, Attribute.
Nicht nur die quantitative Valenz entscheidet dar¨ uber, ob
ein Satz wohlgeformt ist.
Ebenso: Kasus (bestimmte Elemente fordern bestimmten
Kasus)
Thematische Rollen (semantisch muss das Argument zum
Regens passen)
Satzklammern
Im Gegensatz zu Sprachen wie Englisch weist das
Deutsche eine Vielzahl von Wortstellungsvarianten auf.
Die Grundstellung ist daf¨ ur die Verbendstellung (nach
Drach).
Im deklarativen Hauptsatz steht das Verb an zweiter
Stelle (Verbzweitstellung oder V2-Stellung).
Das Verb markiert die Satzklammer.
Vorfeld: vor der linken Satzklammer (LSK)
Nachfeld: nach der rechten Satzklammer (RSK)
Mittelfeld: zwischen linker und rechter Satzklammer
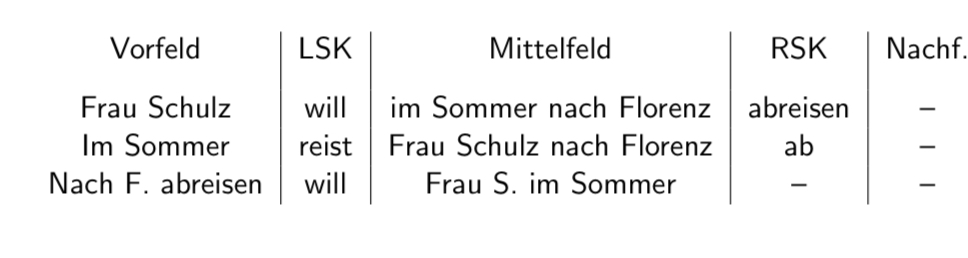
Topologische Felder
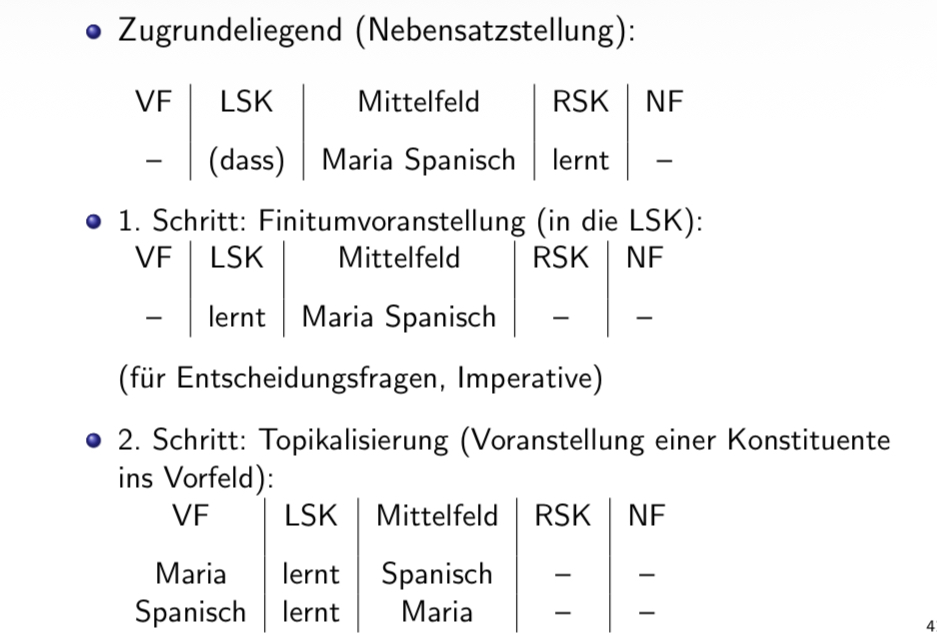
Drach’sche Regeln
(1) a. Verb-Endstellung
Hans fragt, ob Maria Spanisch lernt.
b. Verb-Erststellung
Lernt Maria Spanisch?
c. Verb-Zweitstellung
Maria lernt Spanisch.
Diese S¨ atze sind von einem einzigen Grundmuster ableitbar.
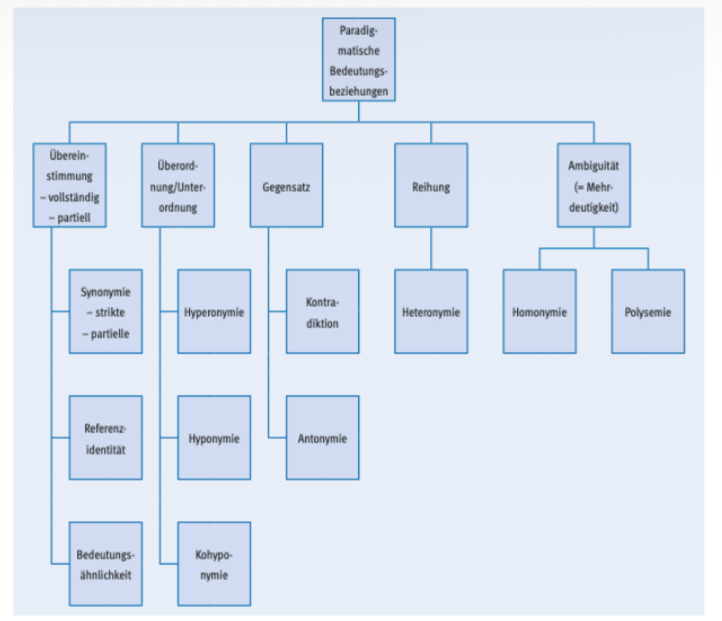
Bedeutungsrelationen
Klammerambiguit¨ at
(2) alte M¨ anner und Frauen aus Hamburg
Ebenso haben wir das Problem von Ambiguit¨ aten
angesprochen. Hier helfen Paraphrasen:
alte M¨ anner und alte Frauen
Frauen und alte M¨
anner
Solche Arten von Ambiguit¨ at gibt es auch in
mathematischen Formeln: 2 3 2 ist ebenfalls mehrdeutig
und muss mithilfe von Klammern disambiguiert werden:
alte [M¨ anner und Frauen]
[alte M¨ anner] und Frauen
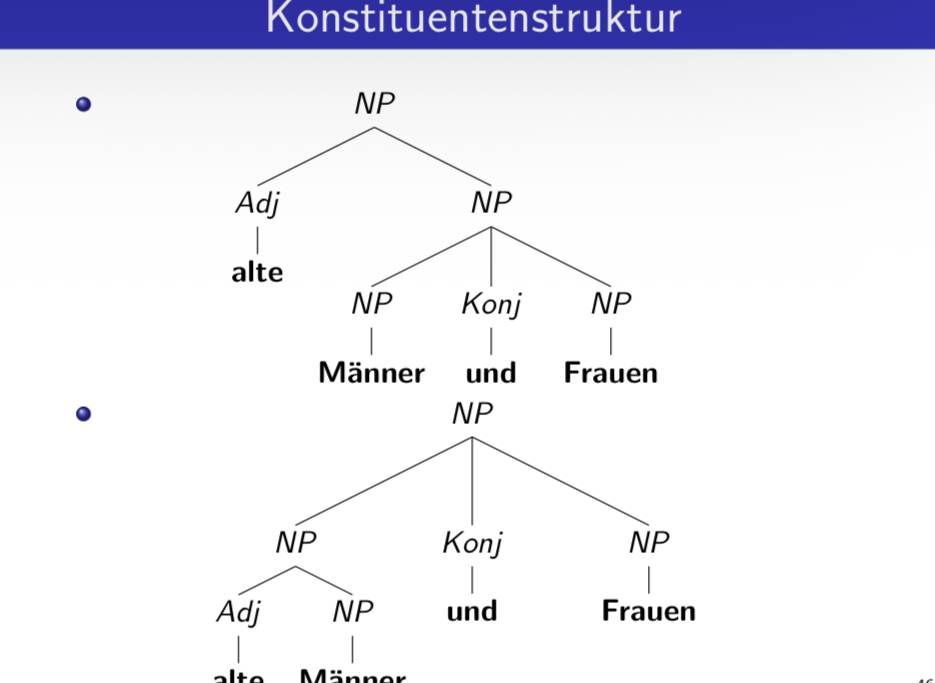
Konstituentenstruktur
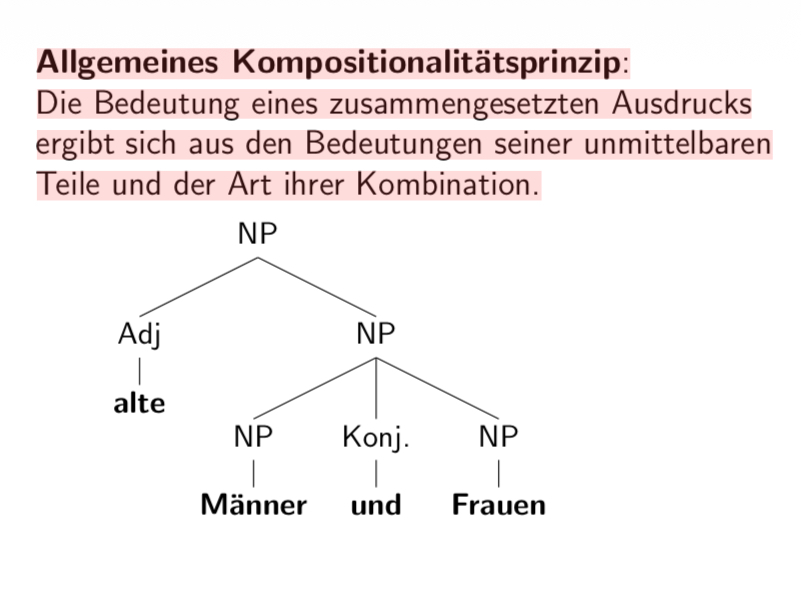
Kompositionalit¨ at
Allgemeines Kompositionalit¨ atsprinzip:
Die Bedeutung eines zusammengesetzten Ausdrucks
ergibt sich aus den Bedeutungen seiner unmittelbaren
Teile und der Art ihrer Kombination.
Bedeutungsebenen
Innerhalb der Bedeutung von sprachlichen Ausdr¨ ucken
werden mehrere Ebenen unterschieden:
Die Ausdrucksbedeutung ist die Bedeutung, die ein
Äusdruck unabh¨ angig von der Äußerungssituation hat.
Die Äußerungsbedeutung ist die Bedeutung, die ein
Ausdruck auf der Basis der Ausdrucksbedeutung abh¨ angig
von der Äußerungssituation hat.
Der kommunikative Sinn einer
Außerung ist die in der Äußerungssituation vom Sprecher intendierte Bedeutung
(auch Sprecherbedeutung).
Dein Hund hat mich gebissen.
Ausdrucksbedeutung: “Ein bestimmter Hund, der dem
H¨ orer des Satzes geh¨ ort, hat den Sprecher des Satzes zu
einem Zeitpunkt vor der Äußerungszeit gebissen.“
Äußerungsbedeutung: “Bella, der Hund von Frau
M¨ uller, hat zu einem Zeitpunkt vor dem 24.3.2003 um 16
Uhr Frederike gebissen.“
Wenn wir nicht wissen, wer tats¨ achlich der Sprecher ist,
wer der H¨ orer ist, um welchen Hund es geht und wann die
Äußerung stattfindet, verstehen wir zwar den Satz (die
Äusdrucksbedeutung), aber wir wissen nicht, was mit dem
Satz gesagt wird (Äußerungsbedeutung).
Pr¨ asuppositionen
Ein weiteres wichtiges Thema waren Pr¨ asuppositionen.
Der K¨ onig von Frankreich hat eine Glatze.
Es existiert ein K¨ onig von Frankreich. (Existenz)
Es gibt nicht mehr als einen K¨ onig von Frankreich.
(Einzigartigkeit)
Hier ist der bestimmte Artikel der
Pr¨ asupposiitonsausl¨ oser. Solche S¨ atze nennt man auch
Existenzpr¨ asuppositionen.
Neben Kennzeichnungen gibt es noch weitere
Pr¨ asuppositionsauslöser.
Faktive Verben (bereuen, sich freuen etc.),
Phrasen¨ ubergangsverben (aufh¨ oren), Partikel (wieder,
immer)
Wie teste ich, ob es eine Pr¨ asupposition gibt?
Negation! Die Pr¨ asupposition bleibt erhalten.
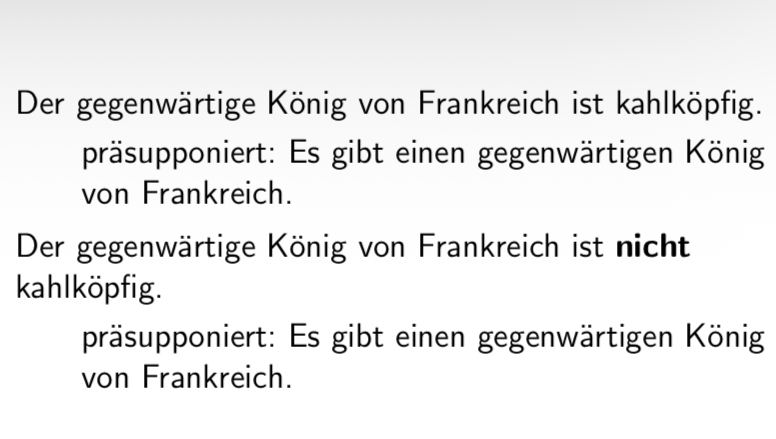
Implikatur vs. Pr¨ asupposition
Gegen¨ uber Pr¨ asuppositionen sind Implikaturen keine
notwendige Voraussetzung f¨ ur das Zustandekommen einer
Äußerungsbedeutung, sondern zusätzliche Äußerungsbedeutungen.
Paul hat drei Geschwister.
⇒Paul hat genau drei Geschwister.
Einige Dozierende kommen vorbereitet in ihre Seminare.
⇒Nicht alle Dozierende kommen vorbereitet.
Annullierbarkeit und Bekr¨ aftigbarkeit
Ebenso k¨ onnen wir Implikaturen annullieren und bekr¨ aftigen:
Paul hat drei Geschwister.
Implikatur ⇒Paul hat genau drei Geschwister.
(7) a. Paul hat drei, wenn nicht sogar vier Geschwister.
(Implikatur annulliert)
B. Paul hat drei Geschwister und nicht mehr als drei.
(Implikatur bekr¨ aftigt)
Konversationsmaximen
Weiterhin haben wir verschiedene (von Grice aufgestellte)
Konversationsmaximen diskutiert:
Maxime der Qualit¨ at (Versuche einen wahren Beitrag zu
machen!)
Maxime der Quantit¨ at (Mache deinen Beitrag so
informativ wie n¨ otig und nicht informativer als n¨ otig!)
Maxime der Relation (Sei relevant!)
Maxime der Modalit¨ at (Art und Weise) (Vermeide
Ambiguit¨ aten, unn¨ otige Ausschweifungen, etc.. Gehe
geordnet vor!)
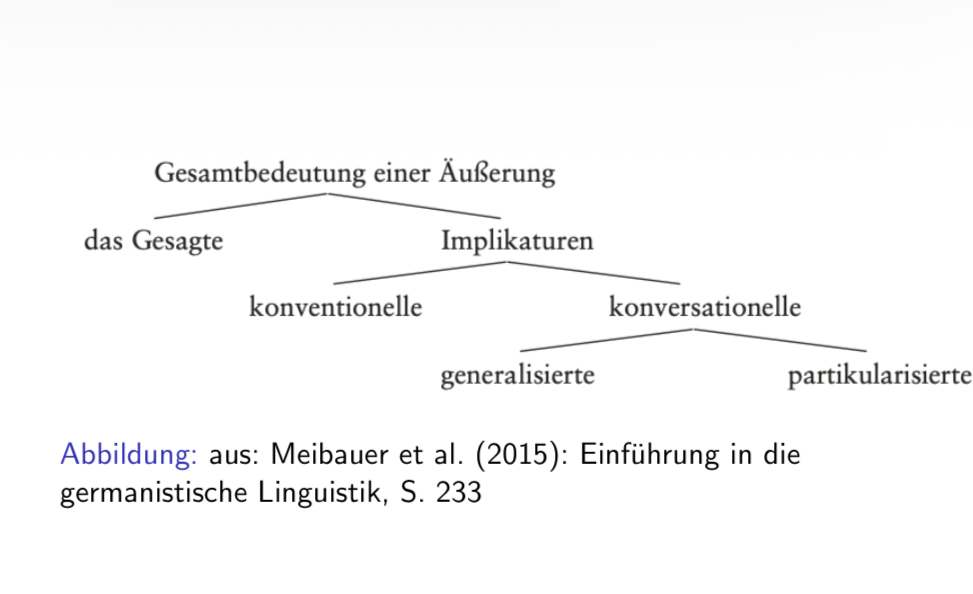
Implikaturen
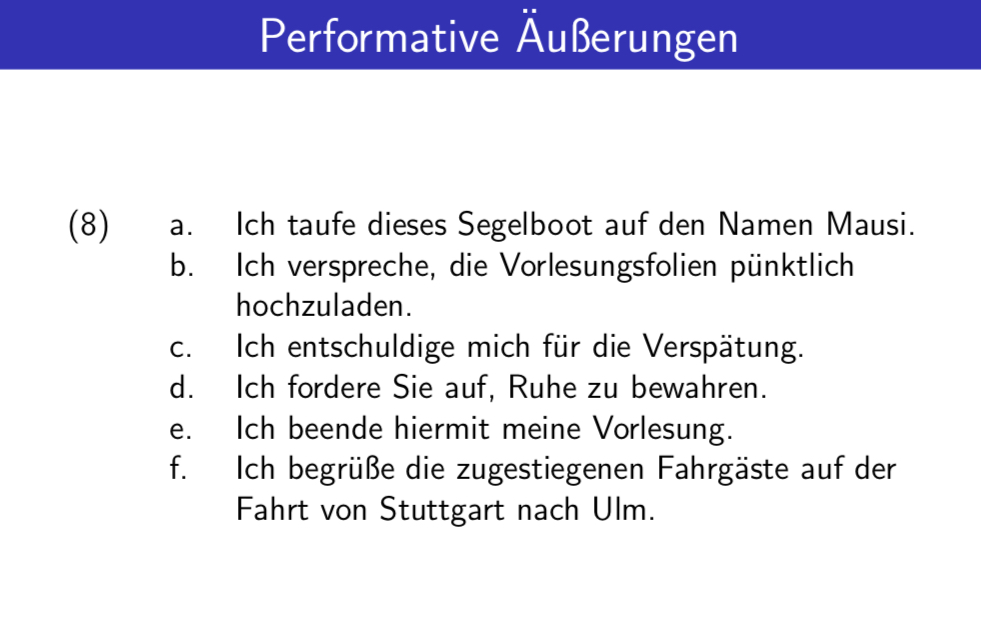
Performative Äußerungen
In Äußerungen mit Verben wie taufen, versprechen,
entschuldigen werden Handlungen vollzogen. Es handelt sich um performative Äußerungen.
Diese Äußerungen unterscheiden sich von einfachen
konstativen Äußerungen, mit denen man etwas sagt,
ohne damit explizit etwas zu tun.
Verben, die in expliziten Performativa die Handlung
bezeichnen, heißen performative Verben.
Illokution und Perlokution
Weiterhin gibt es verschiedene Arten von Sprechakten.
Der Akt, mit dem ich auf etwas Bezug nehme, heißt
propositionaler Akt.
Illokution¨ are Akte sind sprecherbezogen. D.h. der
Sprecher behauptet, tauft, verspricht, l¨ adt ein etc.
Damit ist noch nichts ¨ uber die Wirkung, Konsequenz des
Sprechakts gesagt. Wir wissen nicht, ob der H¨
orer unserer
Bitte nachkommt, ob er sie ¨ uberhaupt versteht.
Wir k¨ onnen mit Sprechakten aber auch direkt eine
Wirkung erzielen, z.B. durch Einsch¨ uchtern,
Uberzeugen,
Umstimmen etc. →perlokution¨ are Akte
Einteilung der Sprechakte
9) a.Äußerungsakt
b. Propositionaler Akt
c. Illokution¨ arer Akt
d. Perlokution¨ arer Akt
Typische Fehler
Achten Sie darauf, diese Fehler zu vermeiden!!!
Phone und Phoneme sind keine Buchstaben!
Im Deutschen k¨ onnen stimmhafte zu stimmlosen
Obstruenten werden, niemals umgekehrt!
sind keine Silben!
Nomen flektieren nicht nach Genus!