Humanbio - Optischer Apparat
1/98
There's no tags or description
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |
|---|
No analytics yet
Send a link to your students to track their progress
99 Terms
Sehen
Wahrnehmung visueller Reize über lichtempfindliche Zelle
Entwicklung Sehsinn
Verschiedene Augentypen, die sich konvergent entwickelt haben
Komplexauge von Insekten
Grubenauge mit ganz kleiner Öffnung für Lichteinfall
Adäquater Reiz
Reiz, auf den ein Rezeptor optimal reagiert -> mit minimaler Energie eine Erregung auslöst
= Reiz für den der Rezeptor die größte Empfindlichkeit besitzt
Adäquater Reiz beim Sehen
Elektromagnetische Strahlung (oder Wellen) / sichtbares Licht = für Menschen adäquater Reiz
Elektromagnetisches Spektrum
Von energiereichen Gammastrahlen im Pikometer-Bereich bis zu energiearmen Radiowellen im Kilometerbereich
Sichtbares Licht nur kleiner Teil
400 Nanometer bis 750 Nanometer
Anthropozentrische Sichtweise, denn es ist vom Menschen aus gedacht
Insekten/ Vögel können bis in den UV-Bereich sehen -> ihr "sichtbares Licht"
Organismen die Infra-Rot sehen können -> Prachtrundbarsche -> Nahrung reflektiert Infra-rot-Strahlung
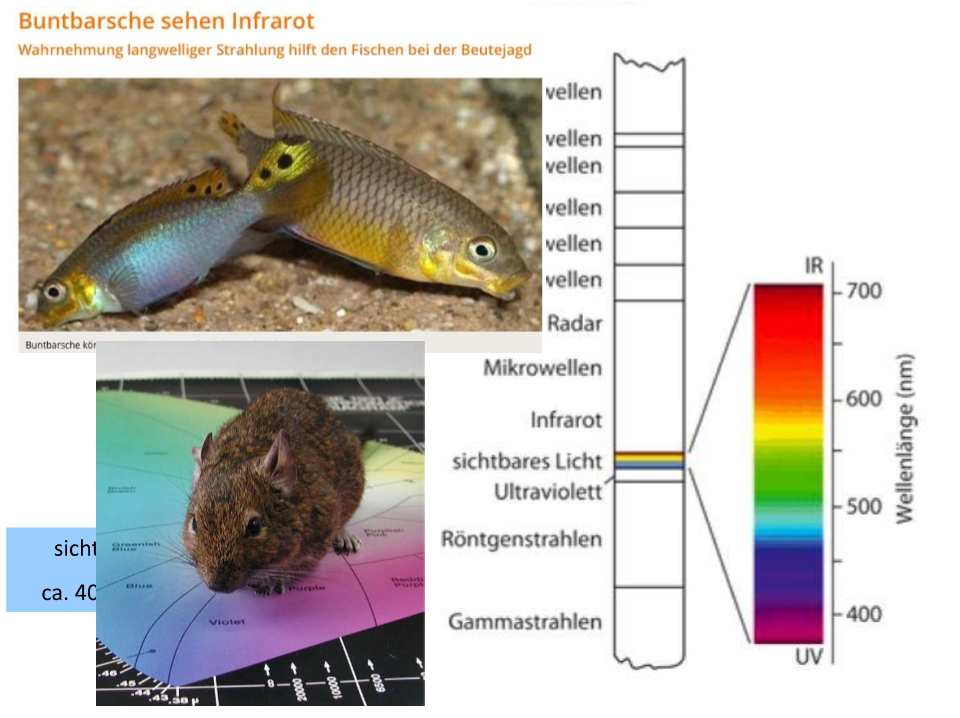
Amplitude (A)
Differenz zwischen Wellenberg und arithmetischem Mittel (Nulllinie)
= maximale Ausdehnung
Wellenlänge
Abstand zwischen 2 Wellenbergen
Frequenz
Hier: 2 komplette Durchgänge pro Sekunde -> Welle hat eine Frequenz von 2 Hertz
Ausbreitungsgeschwindigkeit
Auch Lichtgeschwindigkeit -> Ausbreitung der Wellen im Vakuum als geraden Strahl (Raum ohne Marteria) = 299.792.000 m/s
Abhängig von Frequenz und Wellenlänge
Optik - Definition
Lehre von Lichtstrahlen und ihren Wechselwirkungen mit der Atmosphäre und Objekten
Wie bewegen sich Wellen im Vakkum?
Im Vakuum bewegen sich Wellen gerade als Strahl
Reflexion
Zurückwerfen der Lichtstrahlen von einer Oberfläche
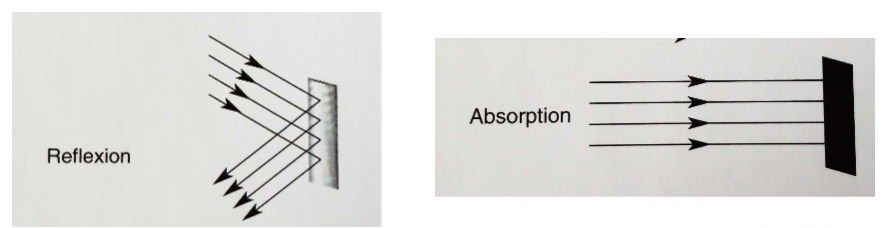
Absorption
Übertragung von Lichtenergie auf einen Partikel oder eine Oberfläche
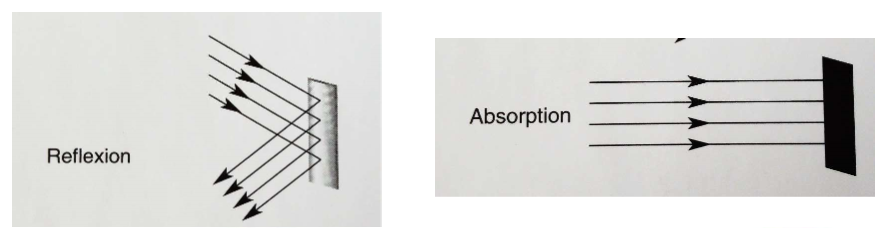
Brechung
Richtungsänderung einer Welle durch die Änderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit in zwei verschiedenen Medien, weil Medien unterschiedliche Dichten haben
Medien mit unterschiedlicher Dichte
Abhängig von Dichte des zu durchquerenden Mediums
z.B. Luft und Wasser haben unterschiedliche Dichte
Wasser hat größere Dichte -> Lichtstrahl wird zum Loht hin gebrochen
Brechzahl
= Ausbreitungsgeschwindigkeit in Vakuum
c0 dividiert durch Ausbreitungsgeschwindigkeit in Medium
Brechzahl Vakuum = c0 = 1
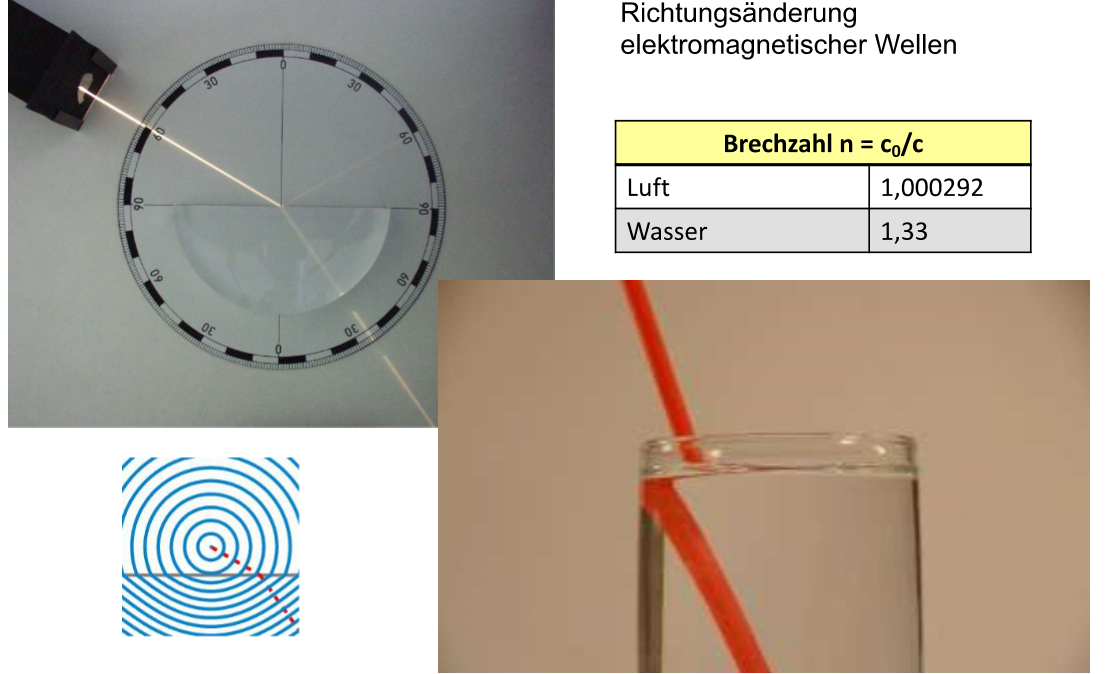
Optische Linsen
In der Regel zwei lichtbrechende Flächen
Mindestens eine Fläche gewölbt - konvex oder konkav
Brennweite f
Abstand des Brennpunktes (Fokus) von der Linse (in m)
Brechkraft D
Kehrwert der Brennweite
Einheit: Dioptrien dpt
D = f1
Arten von Linsen
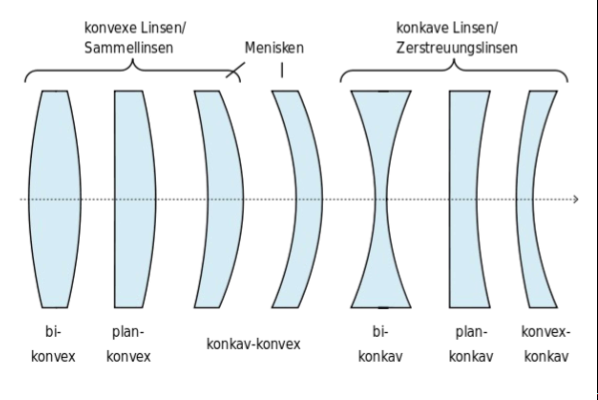
Konvexe und Konkave Linsen - Eigenschaften
Wölbung
Linsenart
Lage des Brennpunkts
Weit- oder Kurzsichtigkeit
Dioptrienzahl
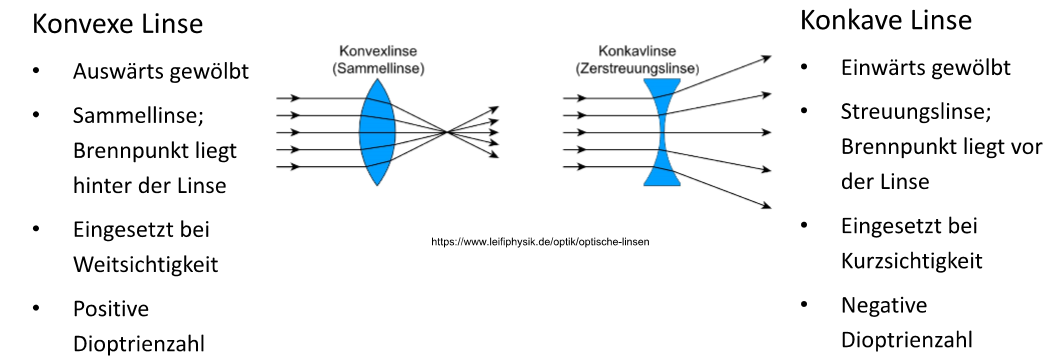
Linsenauge - Abbildung
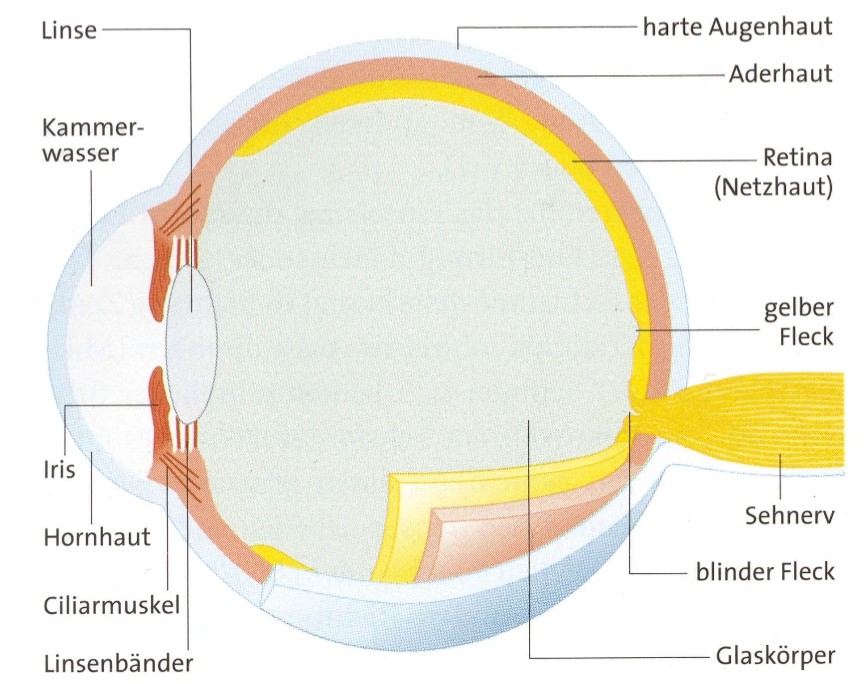
Harte Augenhaut - latein
Sklera
Harte Augenhaut
Bindegewebskapsel -> Form des Bulbus
Hornhaut - latein
Kornea
Hornhaut - Blutgefäße + Krümmung
Kleine Blutgefäße -> durchsichtig
Starke Krümmung -> Lichtbrechung (+43 dpt)
Dioptrischer Apparat - Bestandteile (3)
Hornhaut, Kammerwasser, Linse
Optischer Apparat - Summe der Dioptrien
+59 dpt
Äußere Augenhaut - Bestandteile (2)
Harte Augenhaut + Hornhaut
Mittlere Augenhaut - Bestandteile (3)
Aderhaut + Ciliarkörper + Regenbogenhaut
Ciliarkörper - Aufbau
Ciliarmuskel + Linsenbänder = Zonulafasern
Ciliarkörper - Funktion
Verformung der Linse ->Scharfstellung/ Akkommodation
Regenbogenhaut - latein
Iris
Iris - Funktion
Weite der Pupille durch Irismuskeln variierbar -> Lichteinfall
Akkommodation - Abbildung
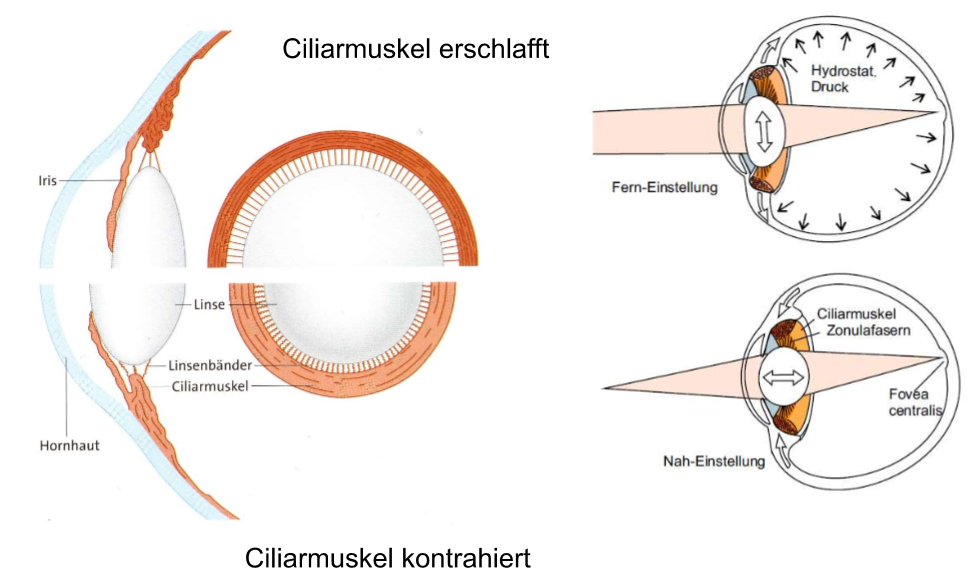
Innere Augenhaut - anderer Name + latein
Netzhaut = Retina
Innere Augenhaut - Bestandteile (2)
Stratum nervosum + Pigmentepithel
Stratum nervosum - Funktion
Lichtempfindlich
Enthält Fotorezeptoren und Neurone
Funktion: Sehprozess
Pigmenthepithel
Melanin
Funktion: unter anderem Stoffaustausch + Ernährung
Blut-Retina-Schranke
Lichtfilter -> Absorption
Linse im menschlichen Auge
Bikonvexe Sammellinse
Glaskörper
Gallertartige Masse
Glaskörper - Funktion
Stützfunktion
Gelber Fleck - latein
Makula
Gelber Fleck - Besonderheiten (2)
Größte Dichte an Sehzellen
Schärfstes Sehen
Sehgrube - latein
Fovea
Sehgrube - Ort
Dünnste Stelle der Netzhaut in der Makula
Zentrale Stelle der Makula
Blinder Fleck
Austritt des Sehnervs
Keine Fotorezeptoren
Weitsichtigkeit - latein
Hyperopie
Weitsichtigkeit - Problem
Bulbus zu kurz
Weitsichtigkeit - Korrektur
durch Sammellinse
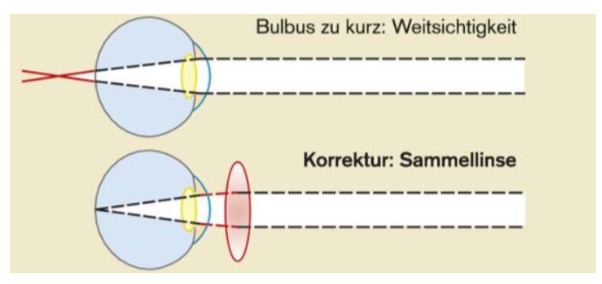
Kurzsichtigkeit - latein
Myopie
Kurzsichtigkeit - Korrektur
durch Zerstreuungslinse
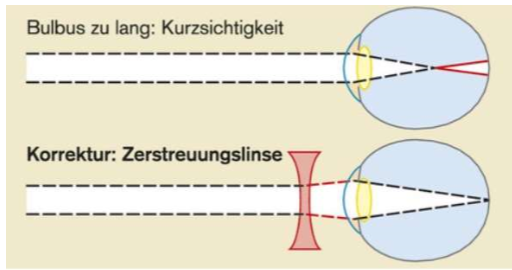
Kurzsichtigkeit - Problem
Bulbus zu lange
Besonderheit Retina im Vergleich bei Wirbeltier und Cephalopoden
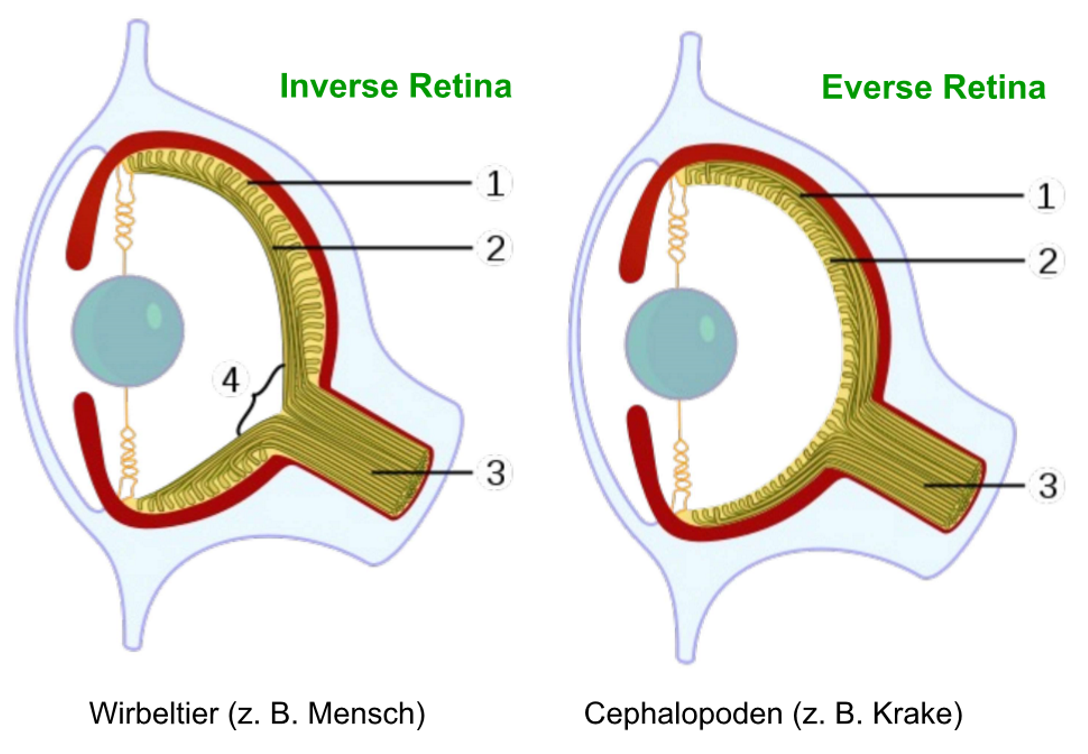
Ciliäre Fotorezeptoren
Membranauffaltungen eines apikalen Ciliums
Außenglied der Stäbchen - Funktion
Lichtabsorbierender Teil
Zäpfchen - Funktion
Farbsehen
3 Typen
Stäbchen - Funktion
hell-dunkel-Sehen
Zapfen und Stäbchen - Abbildung
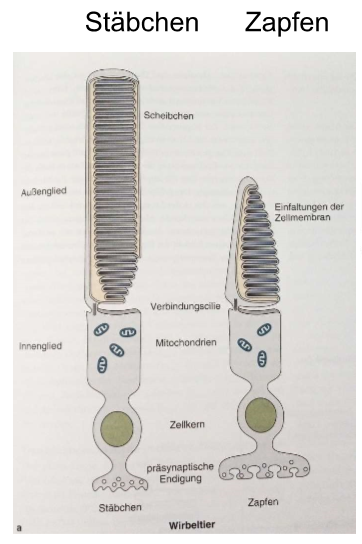
Zapfen und Stäbchen - Funktion - Abbildung
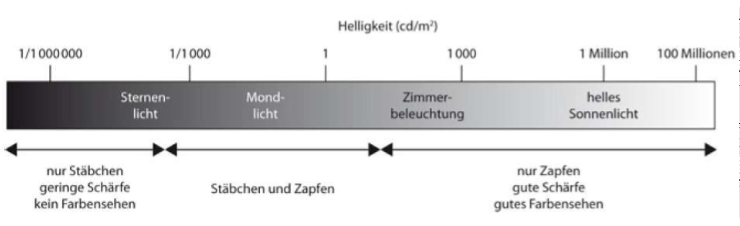
Sehpigment in Stäbchen
Rhodopsin → Retinal + Opsin
Stäbchen - Funktionsweise
Durch Licht ändert sich die Konformation des Retinals
Zapfen - Arbeitsweise
spezifische Zapfenopsine → Iodopsine
Zapfen uns Stäbchen - Abbildung 2
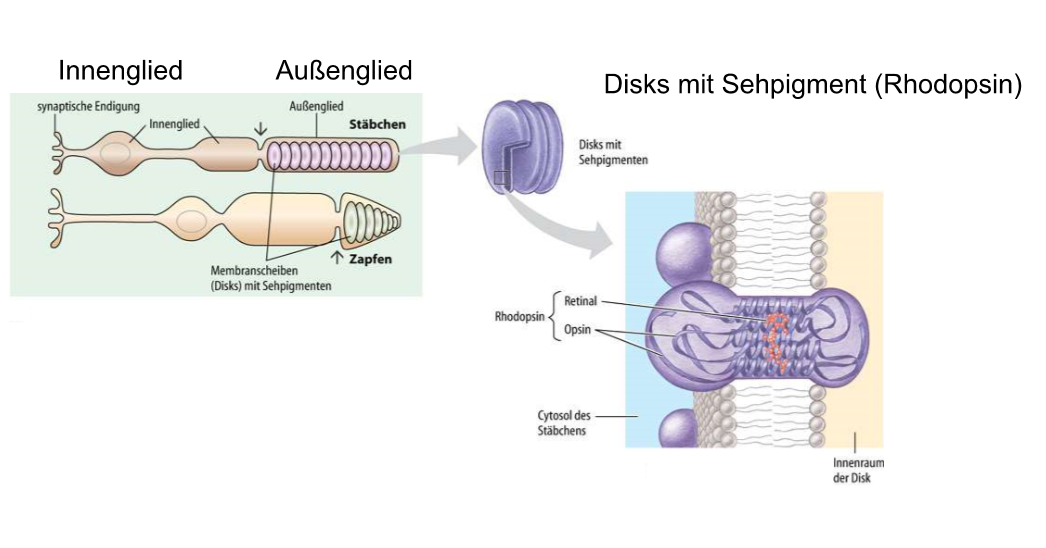
Signaltransduktion im Stäbchen - 4 Zyklen
1. Rhodopsinzyklus
2. Transducinzyklus (Transducin -> G-Protein)
3. PDE-Zyklus
4. GMP-Zyklus
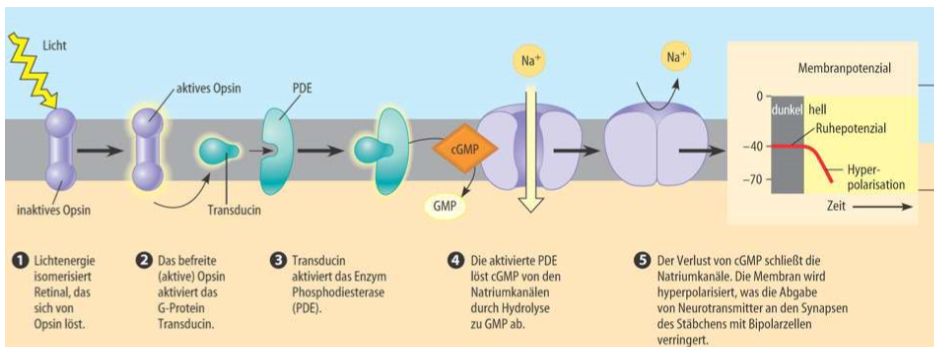
Besonderheit bei Fotorezeptoren im Gegensatz zu anderen Sinneszellen
Hyperpolarisation bei Erregung
Auswirkung von Licht auf die Stäbchen
Je nach Glutamatrezeptortyp wird die Bipolarzelle depolarisiert oder hyperpolarisiert
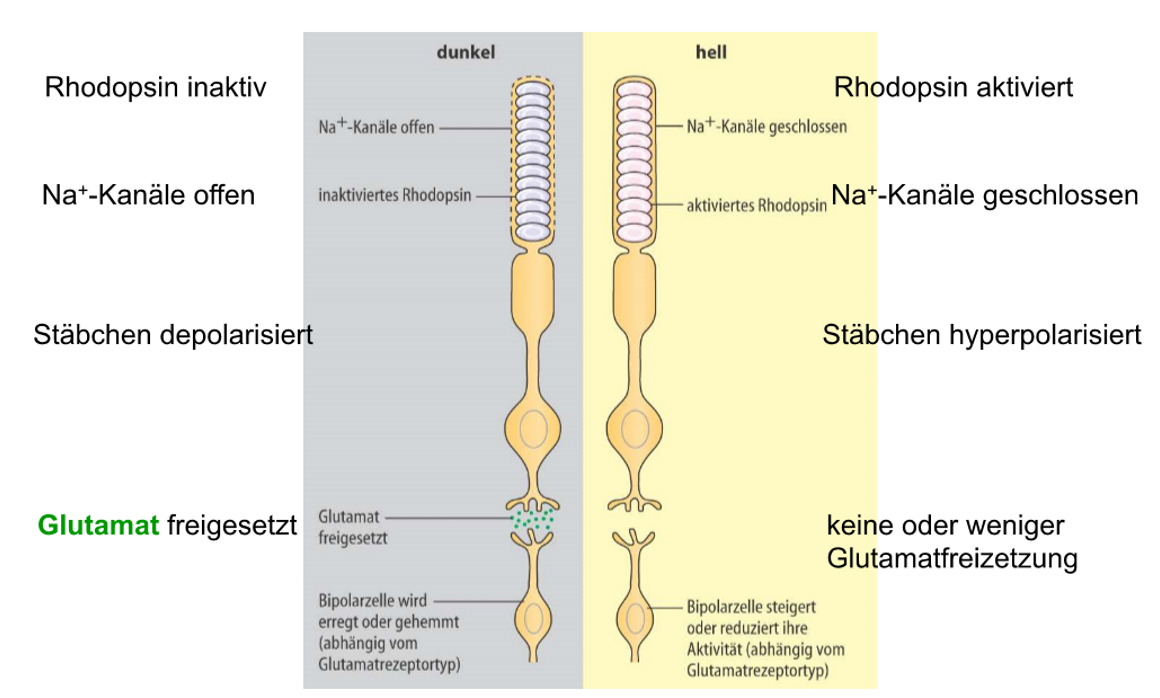
Signalverarbeitung in der Netzhaut - Abbildung
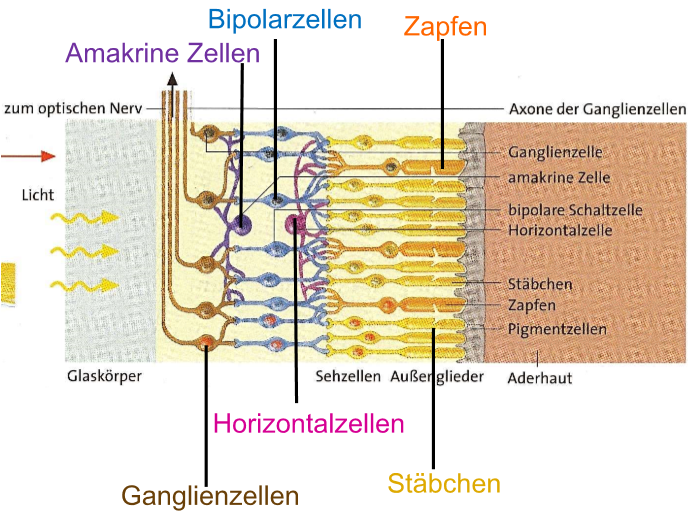
Direkte Verschaltung (Fovea)
Fotorezeptor -> Bipolarzelle -> Ganglienzelle
Laterale (indirekte) Verschaltung
Über Interneurone → Horizontalzellen, amakrine Zellen
Hohe Konvergenz an der Netzhaut
Ca. 130 Millionen Fotorezeptoren -> 1 Millionen Ganglienzellen
Aber: Zapfen in Fovea → 1:1-Verschaltung (nur direkte Verschaltung
Kontrastverstärkung durch laterale Hemmung
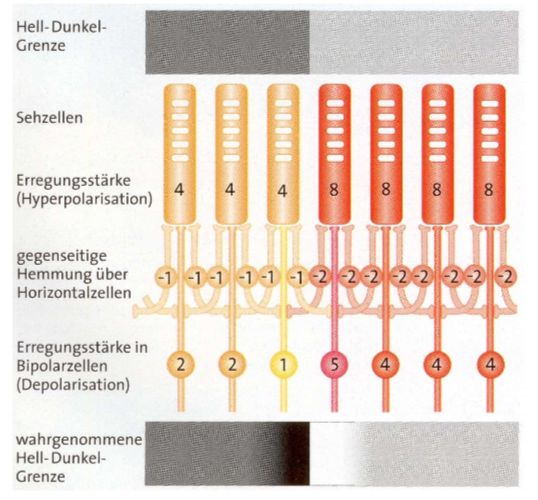
Ganglienzellen in der Retina - Funktion
leiten Informationen über den Sehnerv ins Gehirn
einzige Zellen der Netzhaut, die APs auslösen
haben rezeptive Felder
Rezeptive Felder an der Netzhaut - Funktion Bipolarzellen
Alle Bipolarzellen eines Feldes leiten die Informationen an eine Ganglienzelle
2 Typen von Ganglienzellen
ON- und OFF-Zellen
ON-Zentrum-Zelle
Reagiert bei Licht im Zentrum mit Erregung, bei Licht in Peripherie mit Hemmung
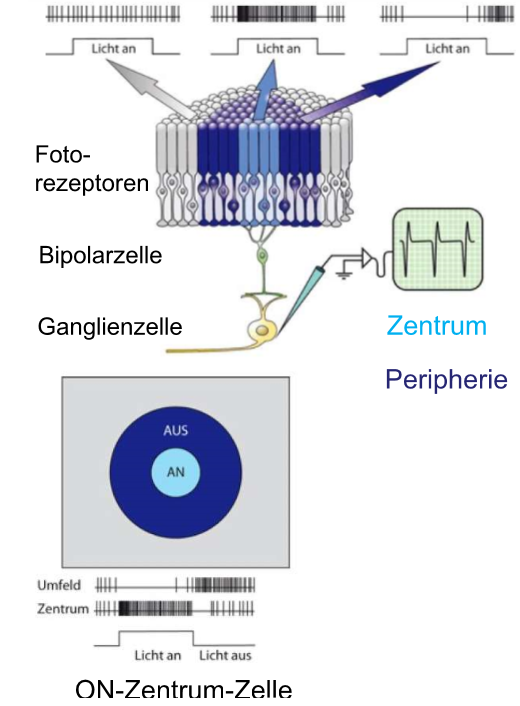
OFF-Zentrum-Zelle
Reagiert bei Licht im Zentrum mit Hemmung, bei Licht in Peripherie mit Erregung
Ganglienzellen - Funktionsweise
Feuern auch spontan (ohne Belichtung)
Können durch Lichtreiz erregt und gleichzeitig gehemmt werden
Haben rezeptive Felder (Fotorezeptoren, die auf eine Ganglienzelle konvergieren)
Farbsehen beim Menschen - Abbildung
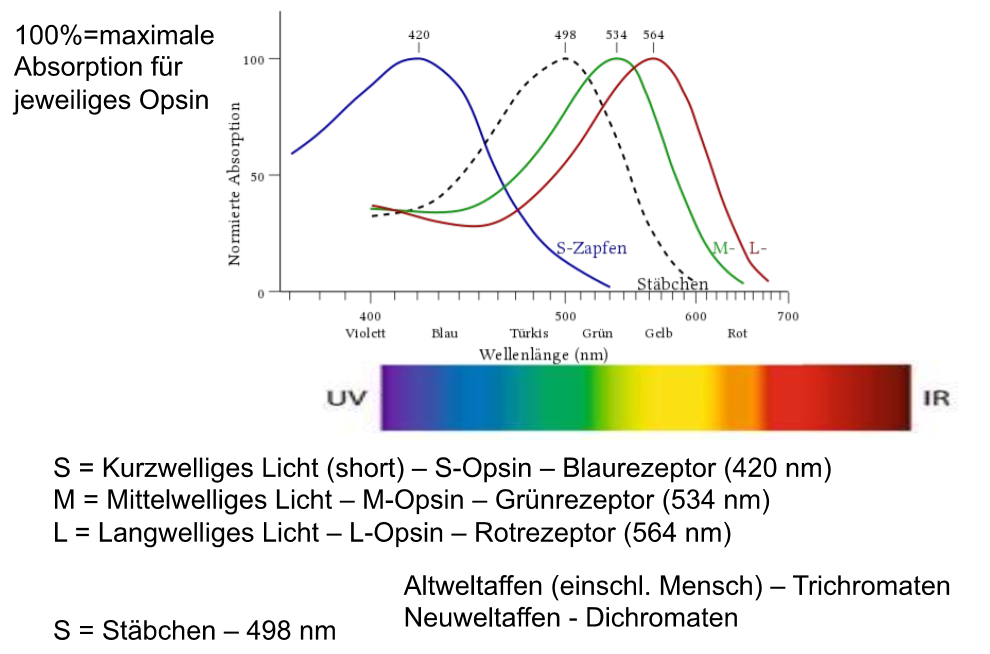
Sehbahn des Menschen
Vollständige Verschaltung (100%) der Informationen der rechten/ linken Gehirnfelder auf die jeweils kontralaterale Seite
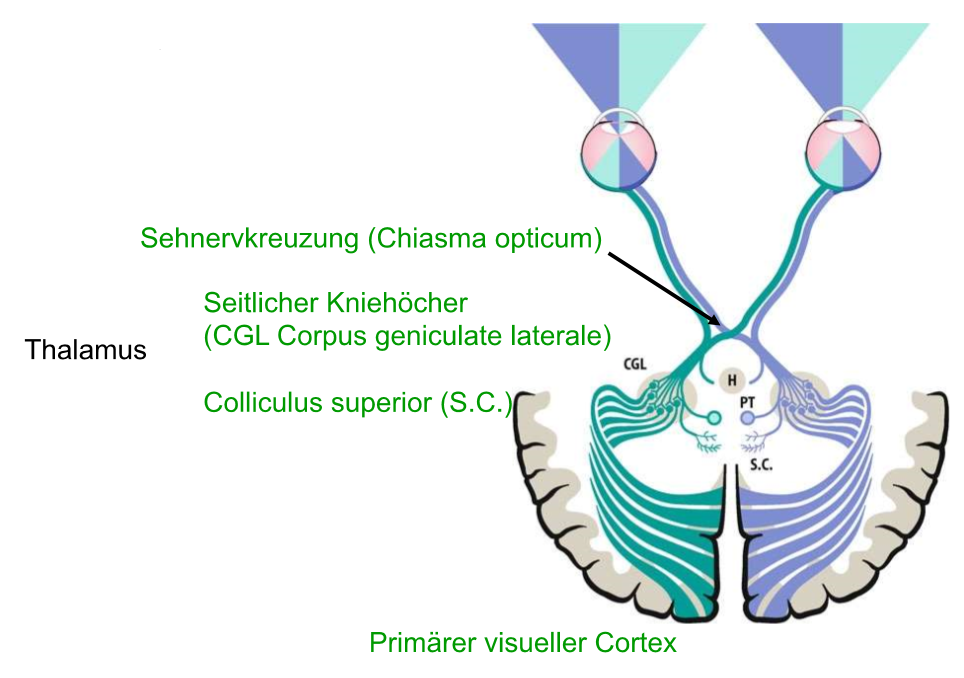
Sehkreuzung - latein
Chiasma opticum
Folgen von Durchtrennung von Teilen der Sehbahn - Abbildung
Durchtrennung des linken Sehnervs
Durchtrennung des linken Tractus opticus
Durchtrennen der Sehnerv-Kreuzung
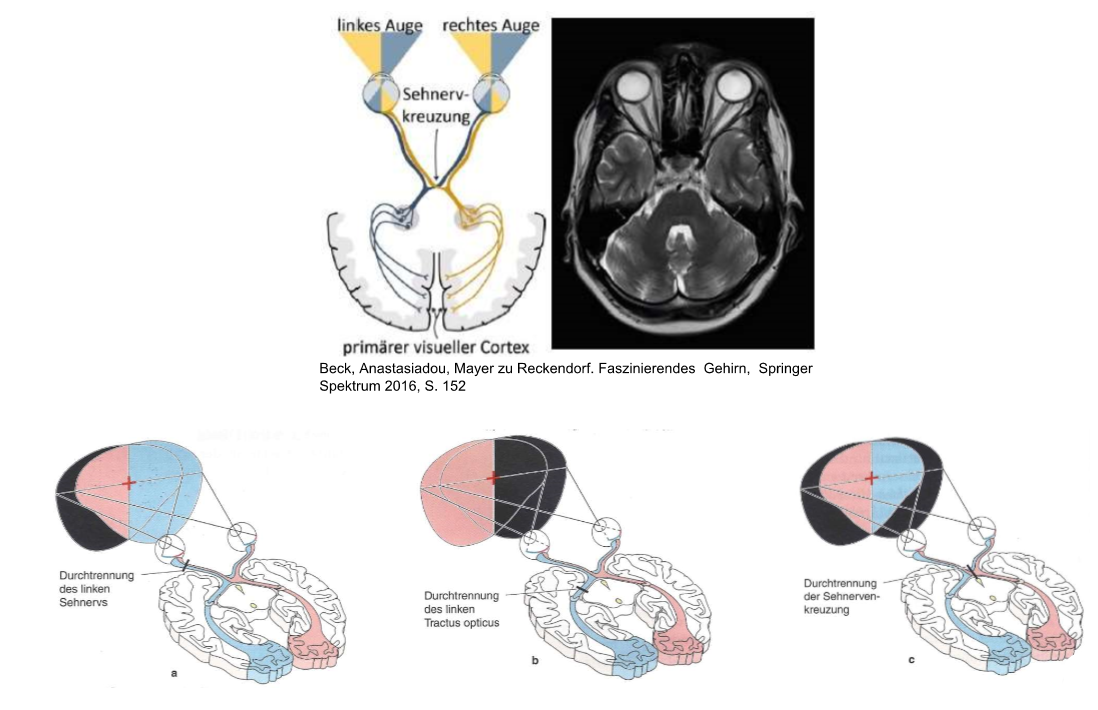
Tractus opticus
Sehbahn, mit der visuelle Information des Auges über Sehnerven und Strahlung zur Sehrinde geleitet werden
Wahrnehmung
das was man mit den Sinnen bemerkt
Wahrnehmung - Funktionsweise und Rolle von Erfahrungen
Reize lösen eine Erregung aus, die an das Gehirn übermittelt und fort ausgewertet wird
Das Gehirn stellt Hypothesen von der Realität auf, dafür greift es auf Annahmen zurück
Annahmen müssen nicht immer richtig sein!
Gehirn kann schneller entscheiden
Gestaltungsregeln bei der Wahrnehmung von Objekten (5)
Gruppierung
Fortsetzung
Gemeinsames Schicksal
Vertrautheit
Einfachheit
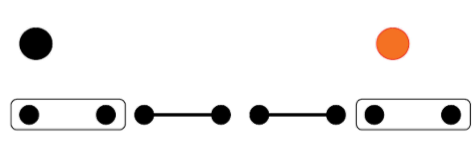
Welche Gestaltungsregel?
Gruppierung
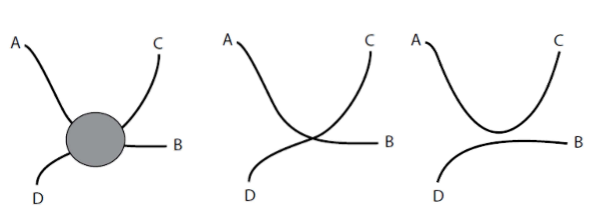
Welche Gestaltungsregel?
Fortsetzung
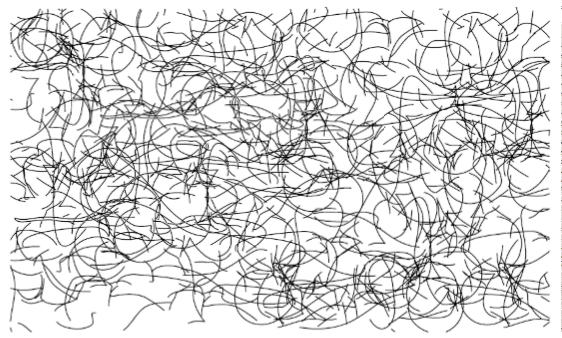
Welche Gestaltungsregel?
Gemeinsames Schicksal
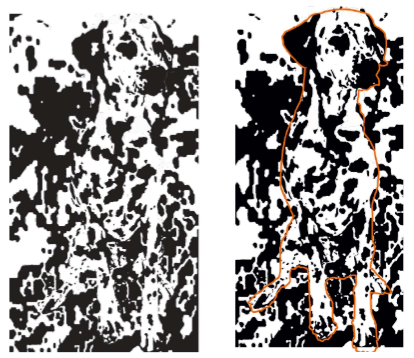
Welche Gestaltungsregel?
Vertrautheit
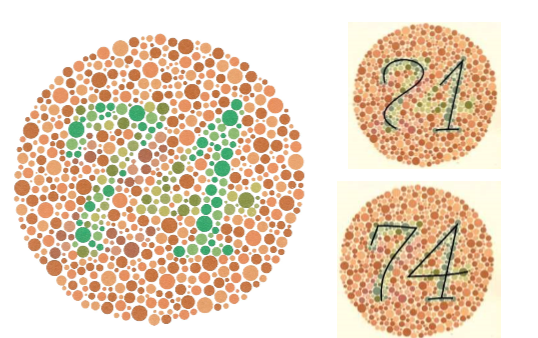
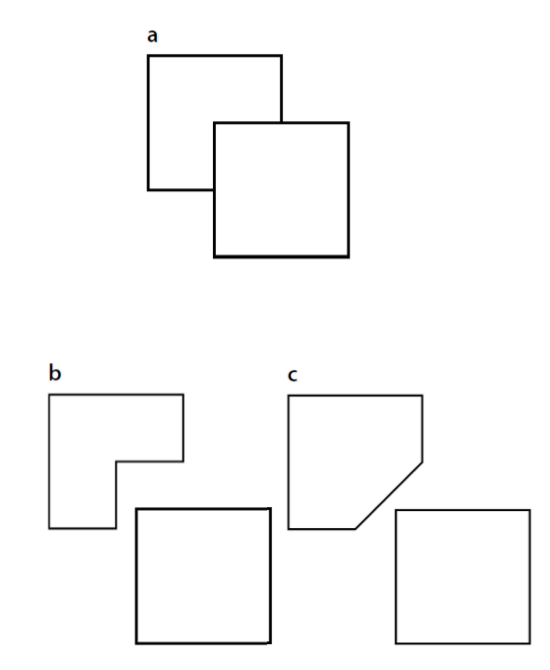
Welche Gestaltungsregel?
Einfachheit
Beispiel Wolf → verschiedene Gestaltungsregeln (4)
Gruppierung
Gleiche Farbe der beiden Hälften des Wolfes
Fortsetzung
Beide Hälften werden mit einer Linie verbunden
Vertrautheit
Verbindet man beide Teile ergibt sich ein vertrautes Muster -> der Wolf
Einfachheit
Es ist wahrscheinlicher, dass es sich um einen Wolf handelt und nicht um zwei
Netzhaut - Aufbau
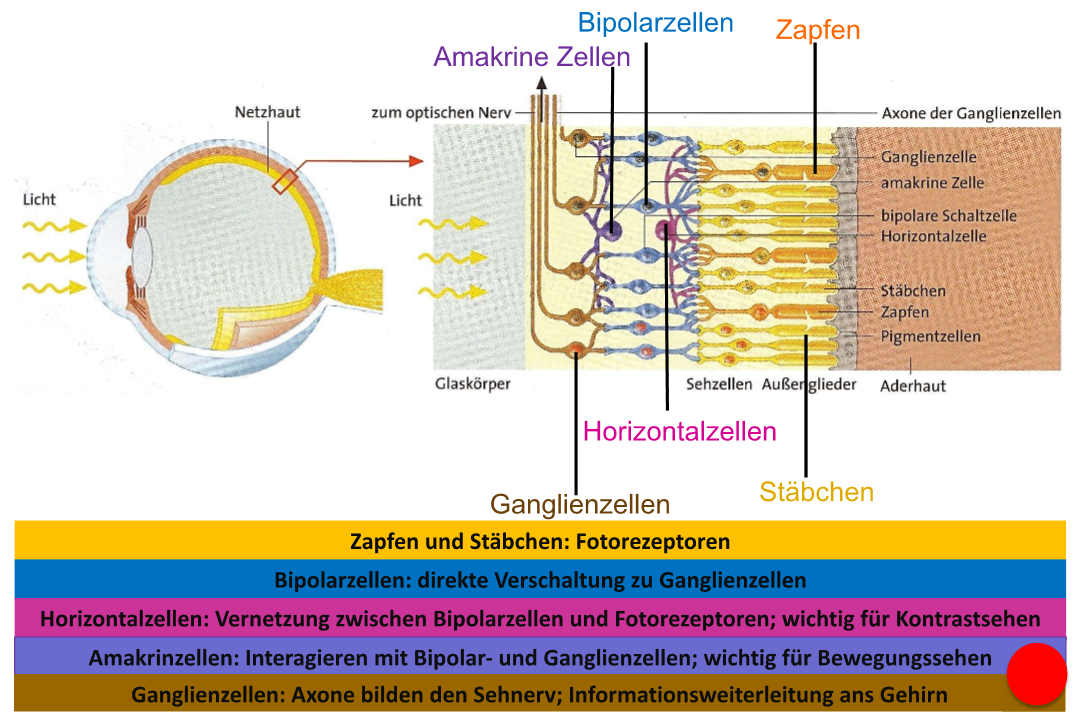
Fotorezeptoren (2)
Zapfen und Stäbchen
Bipolarzellen
direkte Verschaltung zu Ganglienzellen
Horizontalzellen
Vernetzung zwischen Bipolarzellen und Fotorezeptoren → wichtig für Kontrastsehen
Amakrinzellen
Interagieren mit Bipolar- und Ganglienzellen → wichtig für Bewegungssehen
Ganglienzellen
Axone bilden den Sehnerv → Informationsweiterleitung ans Gehirn
Stäbchen - Anzahl
125 Millionen
Zapfen - Anzahl
6 Millionen
Klasse an Fotorezeptoren
intrinsisch fotosensitive Ganglienzellen → 1-3% der Ganglienzelle
→ nur für circadiane Rhythmik zuständig
→ enthalten Melanopsin als Fotopigment