Phonetik, Phonologie, Graphemetik, Morphologie, Syntax, Semantik, Pragmatik
1/213
There's no tags or description
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |
|---|
No study sessions yet.
214 Terms
Womit beschäftigt sich die Phonetik?
Die Phonetik (Lautlehre, Sprachaktlautlehre) untersucht
Sprachlaute in ihren messbaren physiologischen und
physikalischen Eigenschaften.
nur Laute, die mit den menschlichen Sprechorganen
produziert werden (kein Fingerschnipsen, Klatschen o.¨ a.)
Laute, die der sprachlichen Kommunikation dienen (kein
Husten, Niesen o.¨ a.)
Teilbereiche der Phonetik
Phonetik
Akustische Phonetik
Auditive Phonetik
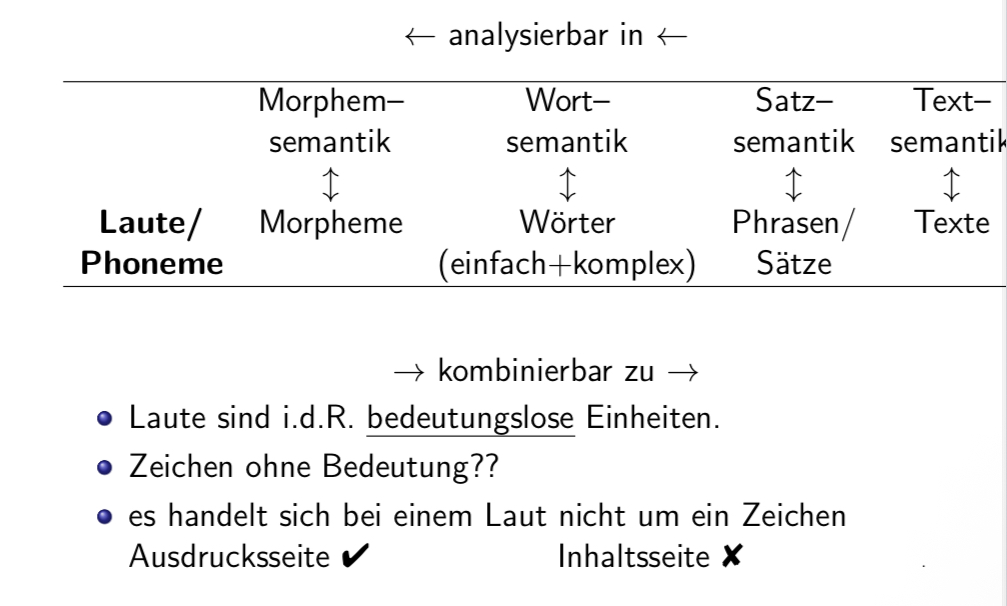
Phonetik und Phonologie in der Linguistik
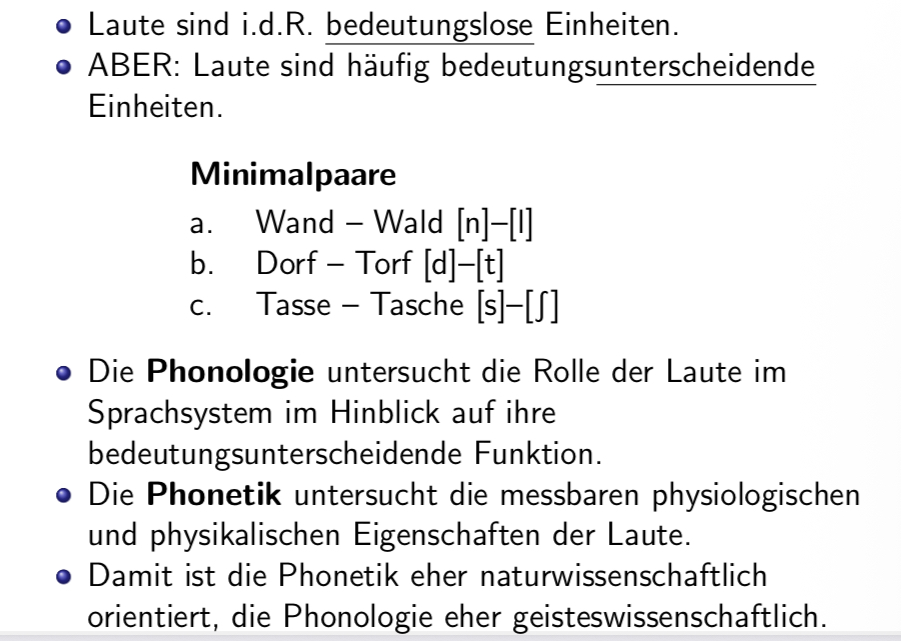
Phonetik und Phonologie in der Linguistik
Die Phonologie untersucht die Rolle der Laute im
Sprachsystem im Hinblick auf ihre
bedeutungsunterscheidende Funktion.
Die Phonetik untersucht die messbaren physiologischen
und physikalischen Eigenschaften der Laute.
Damit ist die Phonetik eher naturwissenschaftlich
orientiert, die Phonologie eher geisteswissenschaftlich. 9
Artikulatorische Phonetik
Artikulatorische Phonetik
beschreibt die Bildungsweise der Laute mit den
Sprechorganen (besonders relevant f¨ ur die phonologische
Klassifikation von Lauten).
Akustische Phonetik
untersucht die physikalischen Eigenschaften des
Sprachschalls.
Auditive Phonetik
untersucht die Wahrnehmung der Laute durch den
Wahrnehmungsapparat (Ohr, Nerven, Gehirn).
Subprozesse bei der Lautbildung
(Ausatmung)
Phonation (Stimmgebung)
Artikulation (Modifizierung des Schallsignals)
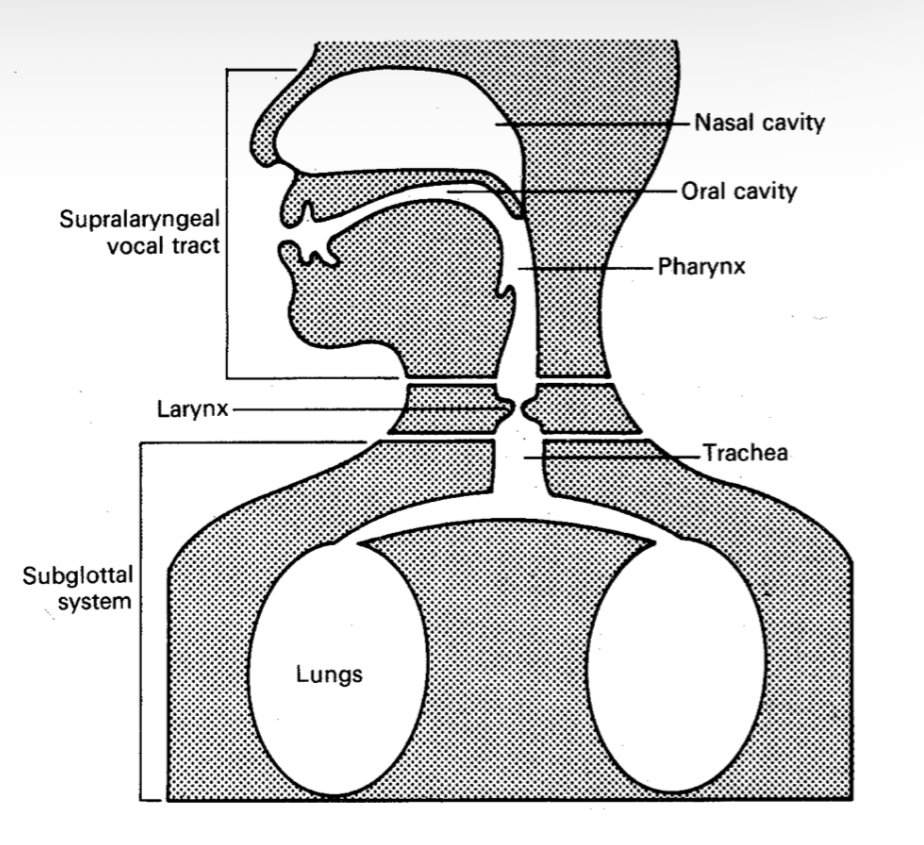
Prozesse der Lautbildung
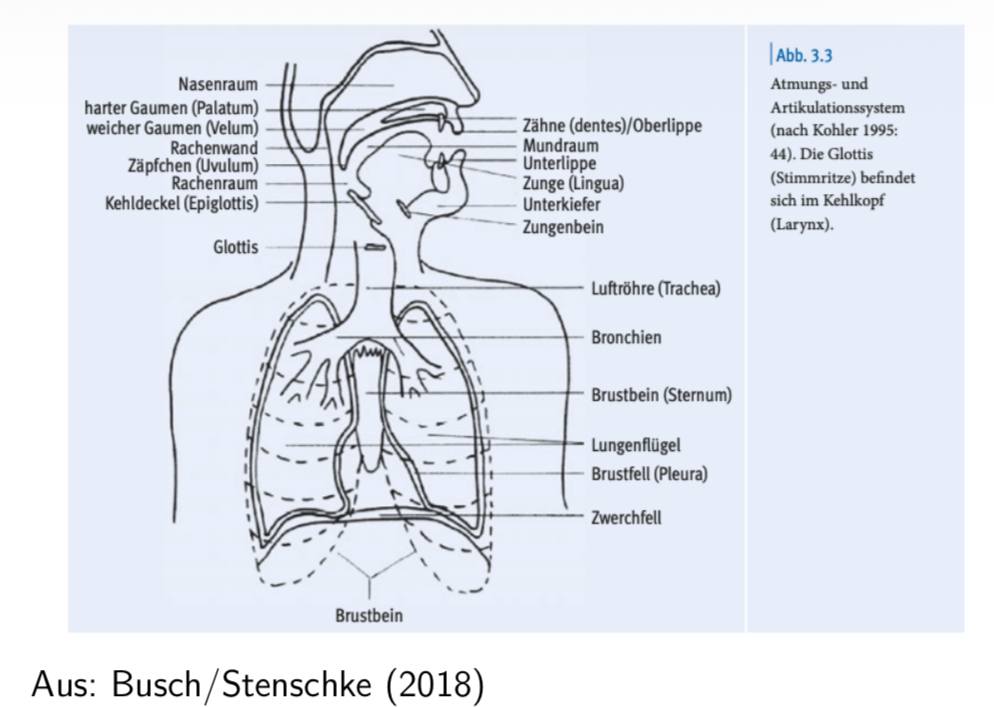
Prozesse der Lautbildung
Initiation
Erzeugung eines Luftstroms, i.d.R. bei der Ausatmung
Phonation (Stimmgebung)
wesentliches Organ: Larynx (Kehlkopf)
Artikulation
Ansatzrohr oder Vokaltrakt: Luftwege oberhalb des
Larynx (Mundraum, Nasenraum)
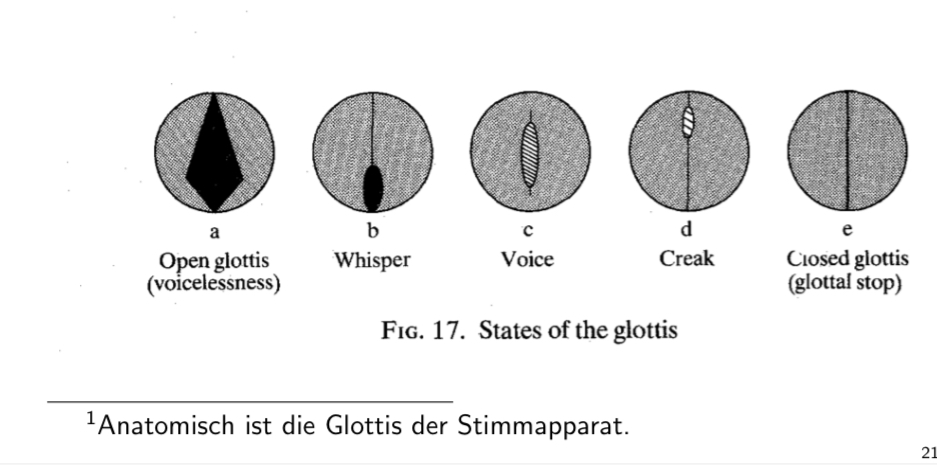
Glottis
Die Glottis (Stimmritze) ist die
Offnung zwischen den
Stimmlippen, die durch die Stimmb¨ ander ver¨ andert wird.1
Sie ist u.a. f¨ ur die Stimmbildung zust¨ andig.
Lautklassifikation
Bei der Lautklassifikation unterscheiden wir zun¨ achst
Konsonanten und Vokale.
Ist das Ansatzrohr (oberhalb der Glottis) offen, entstehen
Vokale.
Ist es verengt oder geschlossen und wird explosionsartig
geoffnet, entstehen Konsonanten.
Die Konstriktion (Verengung oder Verschluss) im
Ansatzrohr sorgt f¨ ur einen Luftdruckunterschied zwischen
Mundraum und Umgebung.
Vokale
Bei Vokalen gibt es keinen Luftdruckunterschied zwischen
Ansatzrohr und Umgebung - der Luftstrom fließt
ungehindert.
Der Resonanzraum wird durch die Position der
Artikulatoren bestimmt. Je nach Position werden
unterschiedliche Vokalqualitäten erzeugt.
Für die Vokalqualitäten sind im Wesentlichen die
Zungenposition und die Lippenrundung entscheidend.
Lautklassifikation
Laute werden in ihrer Bildungsweise klassifiziert
nach Artikulationsart (Art der Konstriktion: Plosiv, Nasal,
Reibelaute (Frikative), Vibranten (Trill), Schlaglaut (tap
oder flap), Approximant)
nach Artikulator
-aktive Artikulatoren
-passive Artikulatoren
nach Artikulationsort
Aktive und passive Artikulatoren
aktive Artikulatoren = bewegliche Organe:
Unterlippe (labium - labial),
Zunge (lingua - lingual), Zungenspitze (apex - apikal),
Zungenkranz (korona - koronal), Zungenblatt (lamina -
laminal), Zungenr¨ ucken (dorsum - dorsal),
Zungenseite (latus - lateral), Stimmritze (glottis - glottal)
passive Artikulatoren = unbewegliche Organe, gegen die
die aktiven Artikulatoren bewegt werden:
Oberlippe (labium - labial), Z¨ ahne (dentes - dental),
Alveolen/Zahntaschen (alveolar), harter Gaumen
(palatum - palatal), weicher Gaumen (velum - velar),
Uvula/Gaumenz¨ apfchen (uvular)
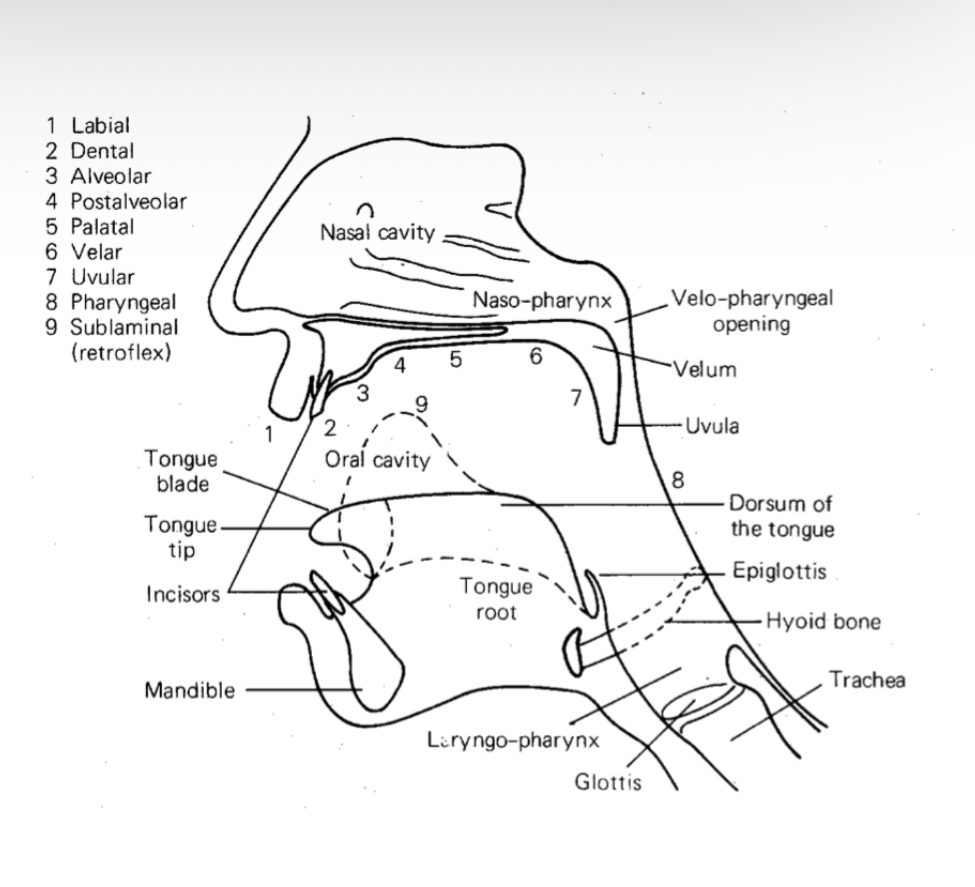
Artikulationsorgane
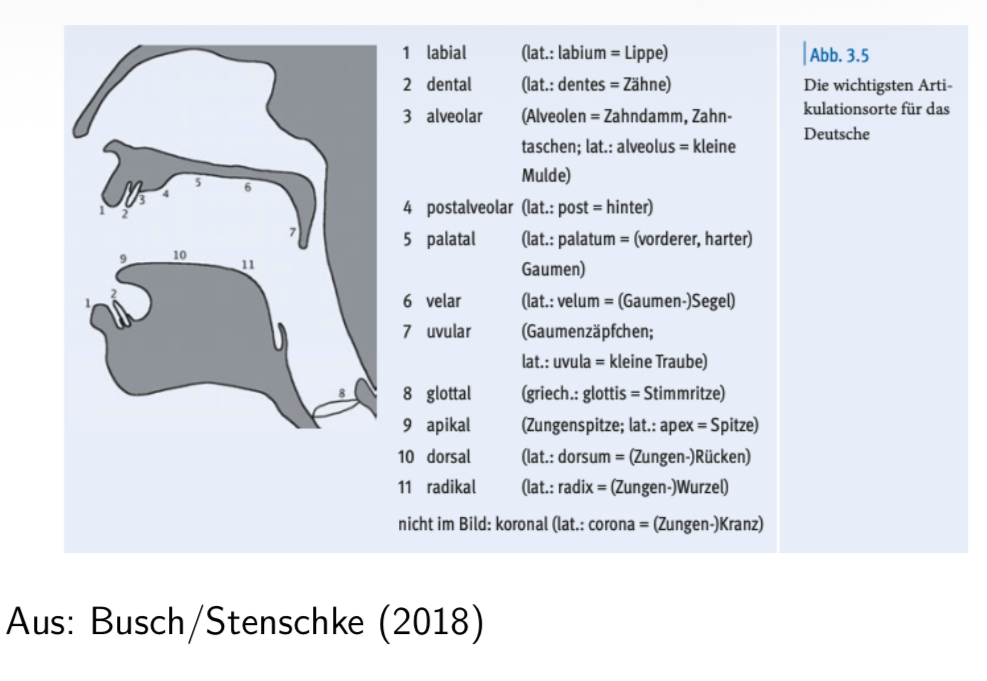
Artikulationsorte
Konsonanten
Konsonanten lassen sich anhand dreier Parameter
klassifizieren:
Artikulationsart, je nach dem, ob der Luftdruckausgleich
relativ pl¨ otzlich (bei Plosiven und Schlaglauten) oder ¨ uber
einen kontinuierlichen Luftstrom erfolgt (bei Frikativen
und Approximanten)
Artikulationsort
: stimmhaft oder stimmlos
(Weiterhin: Nasalit¨ at)
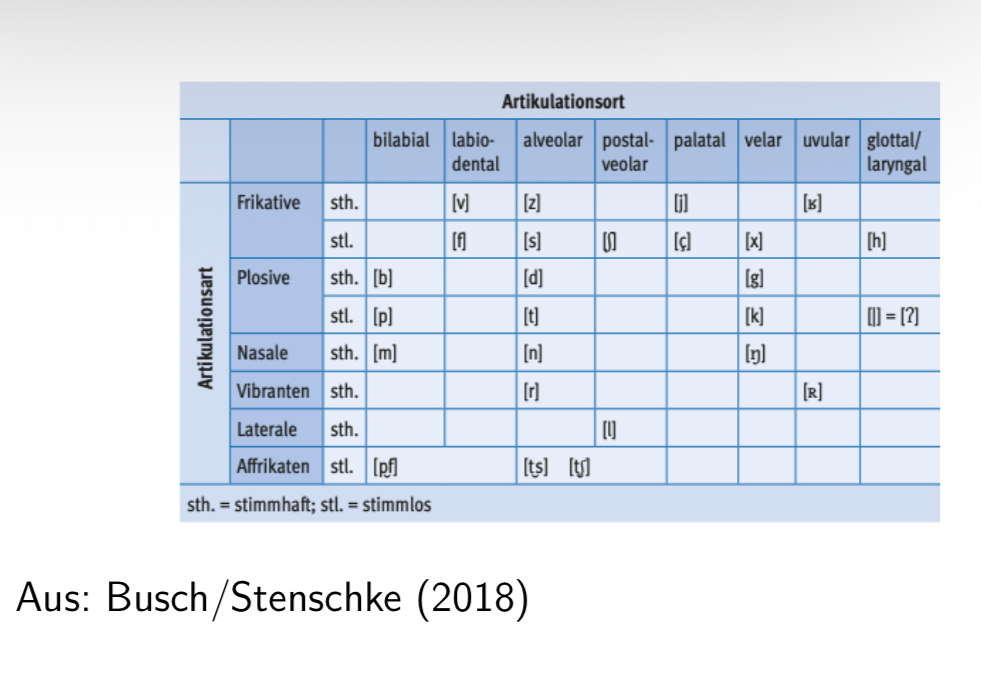
Konsonanten
Konsonanten im Deutschen (klassifiziert nach aktiven und
passiven Artikulatoren)
Labiale:
bilabial: [p, b, m] - Puppe, Bube, Mumie
labiodental: [f, v] - Phase, Vase
Koronale
alveolare: [t, d, s, z, n, l, (r)] - Tüte, Dorn, City, Sahne,
Nase, Lallen, Ritter
postalveolare: [S, Z] - Schuh, Gelee
(dentale: - (engl.: [T,D]) - bath, the)
Dorsale
palatale: [ç, j] - China, ja
velare: [k, g, x] - Kai, Gau, Ach
uvulare: [K] - Ritter
außerdem: [h, ?GlottalerPlosiv ] - Hallo, Au (glottal, laryngal)
Artikulationsarten
Wir m¨ ussen Artikulationsorte von Artikulationsarten
unterscheiden.
Wir unterscheiden grob zwischen Obstruenten, Laute,
bei denen ein Hemmnis überwunden wird, und
Sonoranten.
Obstruenten: Plosive und Frikative (Reibelaute): Der
Luftstrom wird durch Verschluss- oder Engebildung
behindert - Beteiligung von Plosions- oder
Frikativgeräuschen (Luftverwirbelung).
Sonoranten: Nasale, Approximanten, Laterale (auch
Vokale) - keine Ger¨ auschbeteiligung, physikalisch sind
diese Laute als Klang zu betrachten (sie sind spontan
stimmhaft und man kann ihnen eine Tonh¨ ohe zuordnen
Konsonanten
Konsonanten im Deutschen (klassifiziert nach Artikulationsart
und akt. Artikulator)
Plosive: labial: [p, b] - Puppe, Bube; koronal: [t, d]
- Tüte, Dorn; dorsal: [k,g] - Kai, Gau; glottal: [P] -
Be.amter
Frikative labial: [f, v] - Fall, Wall; koronal: [s, z, S,
Z] - City, Suppe, Schutt, Gelee; dorsal: [x, X, K] - Ach,
Kuchen, R¨ ube; glottal: [h] - Haus
Vibranten (Trills) labial: [B] - (nur paralinguistisch
genutzt); koronal: [r] - roh; dorsal: [K] - roh
Nasale labial: [m] - Mama; koronal: [n] - Nonne;
dorsal: [N] - Enge
Laterale koronal/post-alveolar: [l] - lallen;
(Approximanten im Englischen labial: [w] - engl. why;
koronal: [ô] - engl. write)
Stimmhaftigkeit
Bei der Phonation (Stimmgebung) wird ¨ uber die
Stimmhaftigkeit der Konsonanten entschieden.
Stimmhaftigkeit geht mit einer Vibration der Stimmlippen
einher.
Bei Frikativen und Plosiven kommt es im Deutschen
durch dieses Merkmal zu Minimalpaaren.
Übung: Fassen Sie sich an den Kehlkopf und sprechen Sie
die folgenden Wörter aus:
Papa, Bube, Theater, Duden, außerdem, See
Nasale
Wie werden diese artikuliert?
Das Velum (Gaumensegel) entscheidet!
Bei gesenktem Velum strömt Luft durch die Nase. Wenn
das Velum gegen die Rachenhinterwand gehoben ist, wird
der Luftweg durch die Nase versperrt.
Manche Sprachen (z.B. Französisch, Polnisch) haben
produktive Nasale bei Vokalen.
Das Deutsche hat lediglich Konsonanten als Nasale: z.B.
[N] in Anker
38 / 51R¨ uckblick Allgemeines Artikulatorische P
Nasale
Was wäre ein bilabialer Nasal?
z.B. [m] in Hammer!
Können Wörter im Deutschen mit einem velaren oder
bilabialen Nasal beginnen?
Nur mit bilabialem Nasal möglich.
Vokale
Wieviele Vokale hat das Deutsche?
8?: a, ä, a, e, i, o, ö
o, u,ü
17: a, a:, e:, @, E, E:, 5, i:, I, o:, O, ø:, œ, u:, U, y:, Y
a- alle, a:- mahnen,
e:- reden, @ (Schwa) - Sprache, E- nett, E:- MÄhne, 5-
¨ über,
i:- Liebe, I- billig,
o:- loben, O- offen, ø:- st¨ obern, œ- l¨ offeln,
u:- cool, U- lullen, y:-
¨ uben, Y- kn¨ upfen
plus Diphthonge: aI
“, aU “, OY “, UI “
Vokale
Bei Vokalen unterscheiden wir vier Parameter: Vertikale
¨
Zungenlage/
Offnungsgrad, horizontale
Zungenlage/Klangfarbe, Lippenrundung,
gespannt/ungespannt
hohe (geschlossene) vs. tiefe (offene)Vokale (Kling -
Klang) (vertikale Zungenlage)
vordere vs. hintere Vokale (Kiel - cool) (horizontale
Zungenlage)
gerundete vs. ungerundete Vokale (Kiel - k¨ uhl)
gespannte vs. ungespannte Vokale (Miete - Mitte; Mut -
Mutter; H¨ ute - H¨ utte; Ofen - offen)
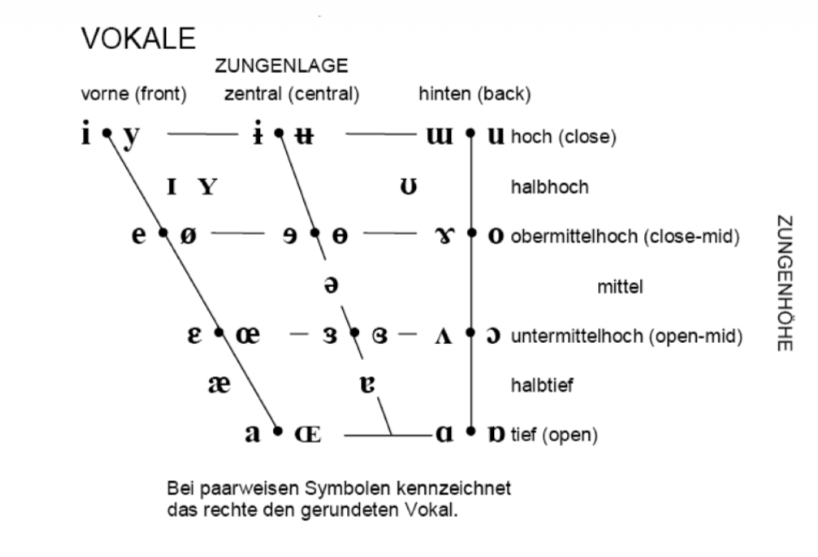
Vokaltrapez
Phon vs Phonem
Für Einzellaute treffen wir die folgende Unterscheidung:
Phon = kleinste im Sprachschall (Lautkontinuum)
unterscheidbare Einheit
Phonem = kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit
der Sprache
Das Phonem entspricht meist dem Phon.
Aber warum brauchen wir dann diesen terminologischen
Unterschied?
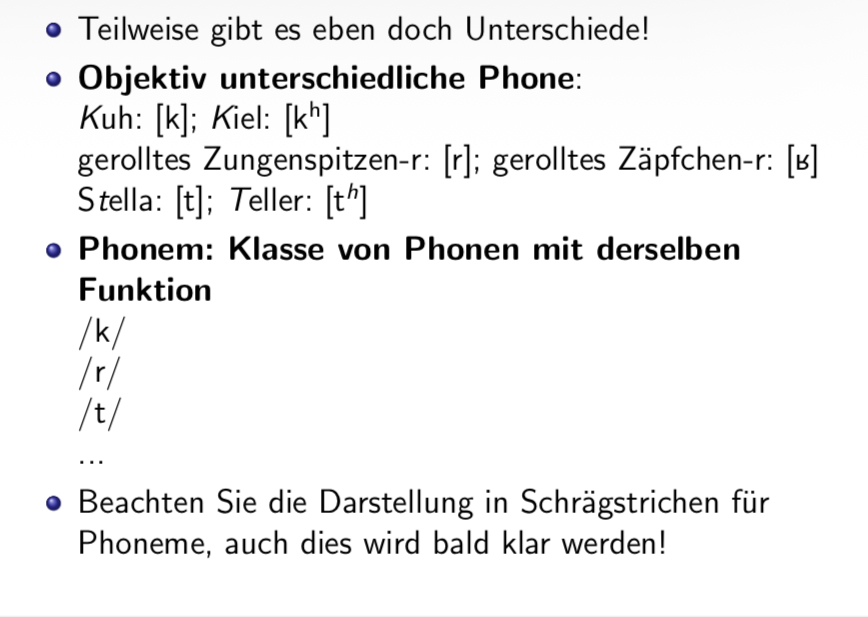
Phon vs Phonem: Notationskonvention
VL 1 CHECKLISTE
Womit sich die Phonetik beschäftigt
Grundsätzliches zur Artikulation von Sprachlauten
Unterscheidungsparameter für Sprachlaute:
Artikulationsarten, Artikulationsorte, aktive und passive
Artikulatoren
Grundlegendes zur Transkription nach IPA
Phon vs. Phonem
Was Sie jetzt wissen sollten:
Grundsätzliches zur Artikulation von Sprachlauten,
IPA
Unterschied Phon und Phonem, Phänomen Allophonie
Phonologische Prozesse
Die Phonologie beschäftigt sich weiterhin mit Prozessen,
die an der (verschiedenartigen) Realisierung von Lauten
beteiligt sind. Eine Auswahl:
Elision: Tilgung von Segmenten (Synkope, Apokope)
Epenthese: Hinzuf¨ ugung von Segmenten
Assimilation und Dissimilation: kontextuell lizensierte
Veränderung von Segmenten
Metathese: Umstellung von Segmenten
Neutralisierung: Kontrastaufhebung (wichtig:
Auslautverhärtung)
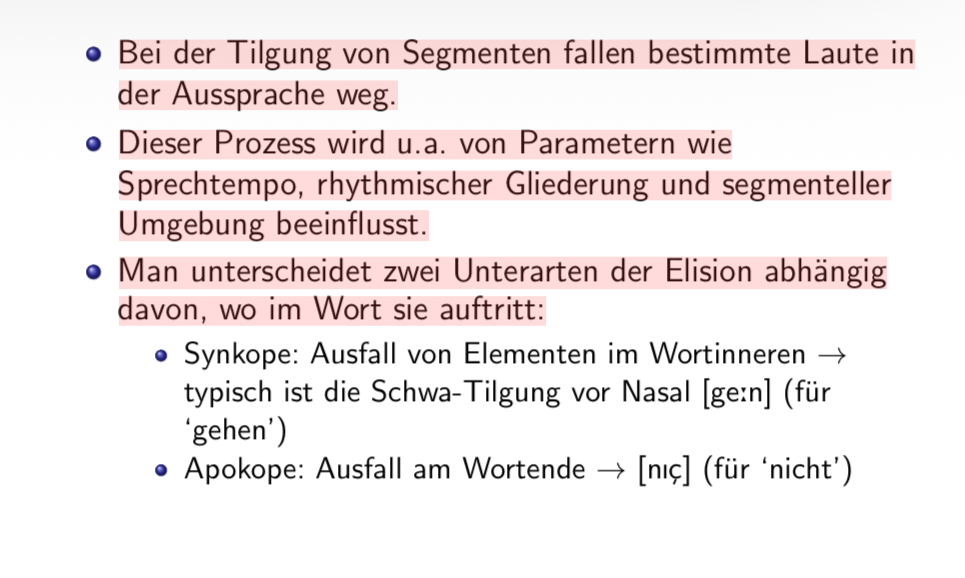
Elision
Bei der Tilgung von Segmenten fallen bestimmte Laute in
der Aussprache weg.
Dieser Prozess wird u.a. von Parametern wie
Sprechtempo, rhythmischer Gliederung und segmenteller
Umgebung beeinflusst.
Man unterscheidet zwei Unterarten der Elision abh¨ angig
davon, wo im Wort sie auftritt:
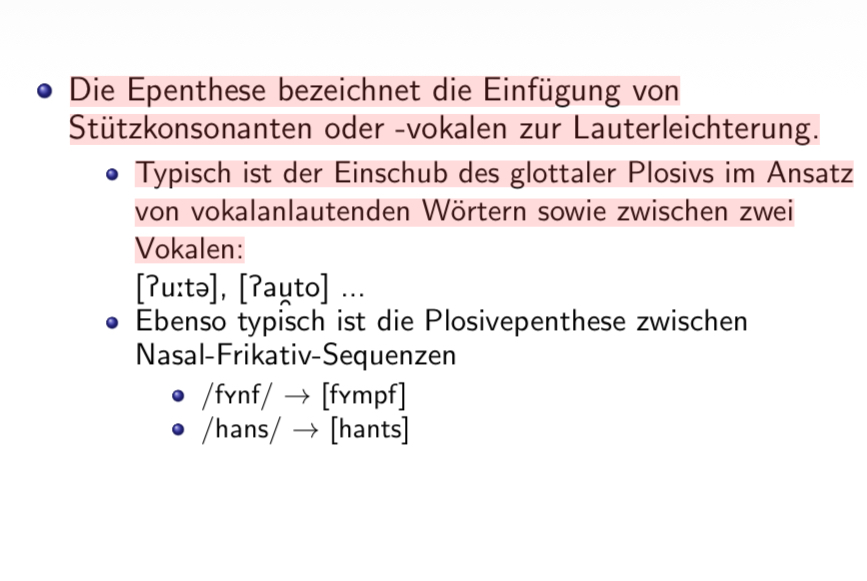
Epenthese
Die Epenthese bezeichnet die Einfügung von
Stützkonsonanten oder -vokalen zur Lauterleichterung.
Typisch ist der Einschub des glottaler Plosivs im Ansatz
von vokalanlautenden Wörtern sowie zwischen zwei
Vokalen:
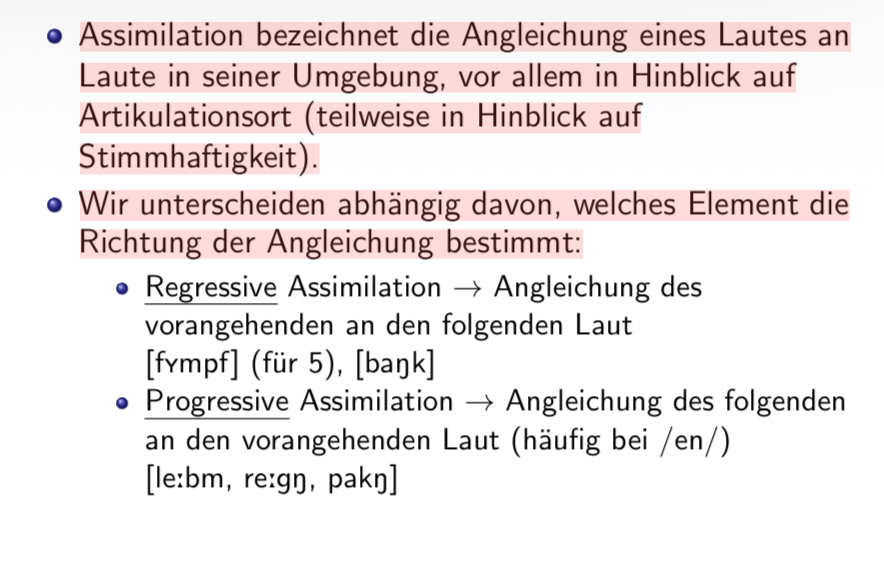
Assimilation
Assimilation bezeichnet die Angleichung eines Lautes an
Laute in seiner Umgebung, vor allem in Hinblick auf
Artikulationsort (teilweise in Hinblick auf
Stimmhaftigkeit).
Wir unterscheiden abh¨ angig davon, welches Element die
Richtung der Angleichung bestimmt:
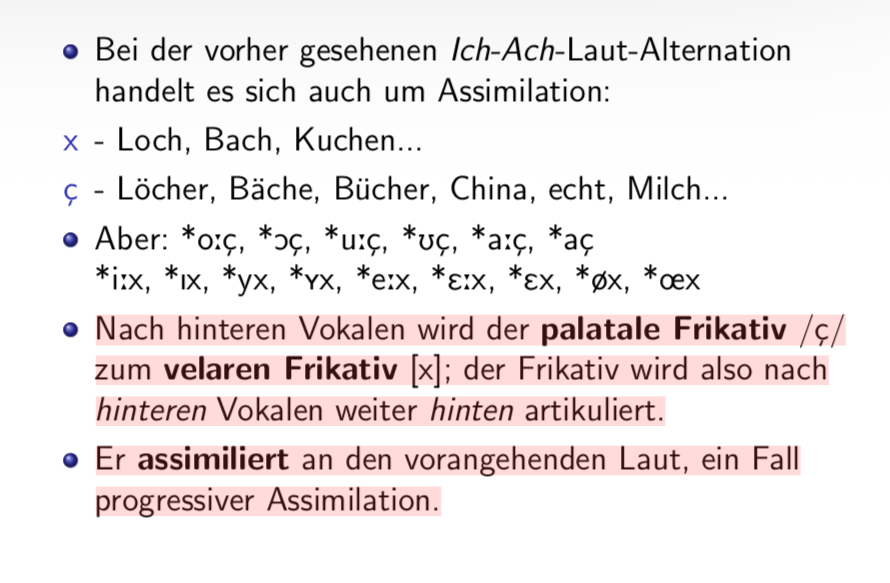
Assimilation
Nach hinteren Vokalen wird der palatale Frikativ /ç/
zum velaren Frikativ [x]; der Frikativ wird also nach
hinteren Vokalen weiter hinten artikuliert.
Er assimiliert an den vorangehenden Laut, ein Fall
progressiver Assimilation.
Dissimilation
Bei der Dissimilation hingegen wird etwas hinzugefügt
oder verändert.
Häufig historisch: lat. -alis / aris -Alternation: navis -
navalis; sol - solaris
Ein typisches Beispiel tritt bei Reduplikation auf, so
auch im Deutschen:
wischiwaschi, Krimskrams, Mischmasch, krikelkrakel
wischiwischi, *kramskrams, *mischmisch, *krakelkrakel
Schickimicki, Techtelmechtel, Kuddelmuddel
Schickischicki,* Techteltechtel, *Kuddelkuddel
Metathese
Metathese bezeichnet eine Lautumstellung innerhalb eines
Wortes.
Diese kann sich sprachübergreifend zeigen, z.B. bei
Eigennamen: Roland – Orlando – Ronaldo
s. ebenso Krokodil – span. cocodril
Metathese ist häufig in der Kindersprache zu beobachten
und tritt auch bei Legasthenie auf:
‘Ulrike’ wird realisiert als [u:Kilk@]
‘Salagne’ f¨ ur ‘Lasagne’
Auslautverhärtung
Ein wichtiges Phänomen im Deutschen ist die sog.
Auslautverhärtung, eine Unterart der Neutralisierung.
Am Silbenrand werden stimmhafte Obstruenten
(Plosive, Frikative) stimmlos ausgesprochen.
Dies führt zu einer Diskrepanz zwischen lautlicher und
schriftlicher Repr¨ asentation!
Beispiele: Hund: [hUnt]
bunt: [bUnt]
Maus: [maUs]
doof: [do:f]
Weg: [ve:k]
Auslautverhärtung
Aber vergleiche z.B. Hund - Hunde [hUnt - hYnd@]
Maus - Mäuse: [maUs - mOYz@]
doof - doofe: [do:f - do:v@]
Aber: nass - NÄsse : [nas - nEs@]
Grund: Innerhalb eines Wortes bleibt die Stimmhaftigkeit
bestehen, wenn der Konsonant als Beginn der n¨ achsten
Silbe fungiert.
Allerdings nicht an Silbenrändern, genauso wenig wie an
Worträndern:
Bündniss - [bYntnIs]
D.h. stimmhafte Obstruenten gibt es nur im Silbenansatz!
Auslautverhärtung
Frage: Was ist also das zugrundeliegende Phonem beim
finalen Laut des Wortes ‘Hund’? /d/ oder /t/?
Das zugrundeliegende Phonem ist /d/!
Denn der phonologische Prozess der Auslautverh¨ artung
macht in bestimmten Kontexten aus einem stimmhaften
einen stimmlosen Obstruenten. Entsprechend ist der
stimmhafte Obstruent zugrundeliegend. Im Deutschen
gibt es keinen Prozess, der aus einem stimmlosen einen
stimmhaften Obstruenten macht!
Zusammengefasst: Im Wort ‘Hund’ sind [d] und [t]
Allophone zu dem Phonem /d/.
Suprasegmentalia / Prosodie
Wir haben gelernt, dass es stimmhafte Obstruenten nur
im Silbenansatz gibt. Die Auslautverhärtung findet dafür
am Silbenende statt.
Mund - (des) Mundes - Mund(art) [mUnt - mUnd@s -
mUnt]
Hier bildet die prosodische Struktur (Betonung) Domänen
für phonologische Beschränkungen oder Regeln. Sie muss
daher Teil der phonologischen Repräsentation sein.
Ein weiteres Beispiel: Im Englischen ist /kn/ im
Silbenansatz unzulässig: know vs. acknowledge
Aber was ist eigentlich die Silbe?
Die Silbe
Die Silbe wird üblicherweise als die kleinste
suprasegmentale Sprecheinheit definiert (aber s.u.).
Eine Silbe besteht mindestens aus einem Silbenkern, auch
Nukleus genannt - i.d.R ein Vokal.
Die zweiten Silben in Bea [be:.a] und Theo [te:.o]
bestehen nur aus einem vokalischen Nukleus.
Die Silbe
In den allermeisten F¨ allen haben Silben auch einen
Ansatz (auch: Onset/Kopf), dieser kann auch komplex
sein.
Jedes Wort hat mindestens einen Ansatz! aber, Uhr,
schlank, Pflicht [Pa:.b5, Pu:5 “, SlaNk, pflIçt]
Schließlich haben viele Silben einen Endrand, die Koda,
welche auch komplex sein kann.
Tag, Rumpf, Quark [ta:k, KUmpf, kvaKk]
Nukleus und Koda bilden den Reim.
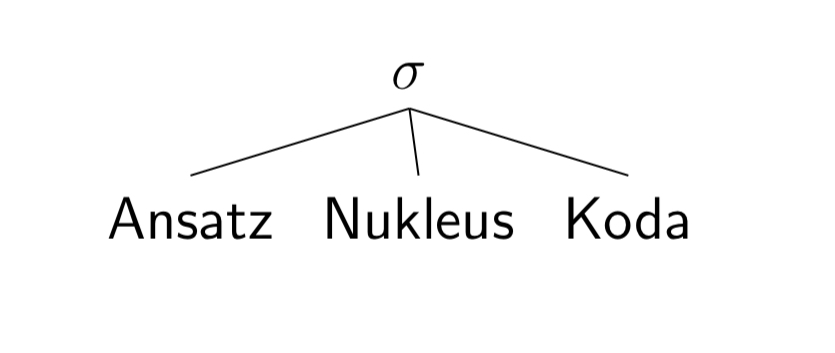
Konstituenten der Silbe
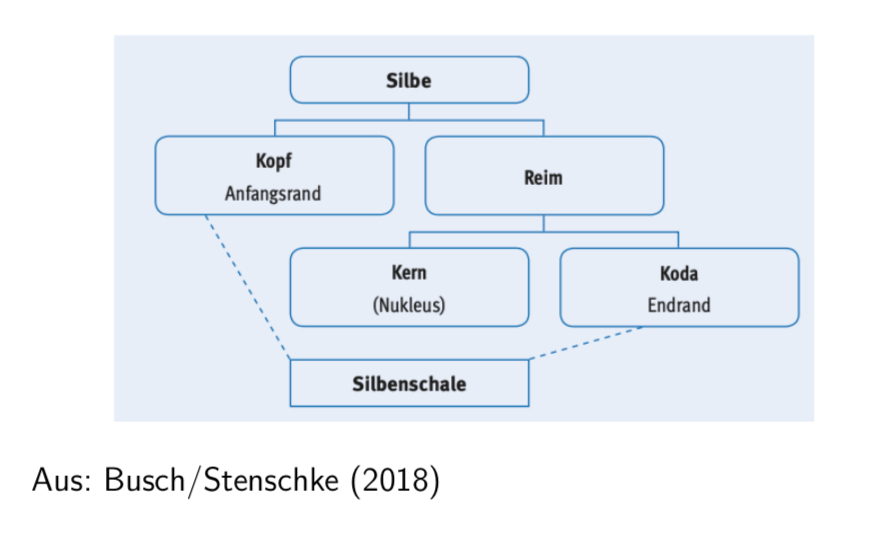
Silbenstruktur
Konstituenten der Silbe
Dies führt dazu, dass sich viele Wörter reimen.
Saum, Raum, Baum, kaum, Flaum
Rind, Kind, Wind, geschwind
Dies zeigt eine wichtige Abhängigkeit von Nukleus und
Koda (nicht aber von Ansatz und Nukleus) - mehr dazu
gleich.
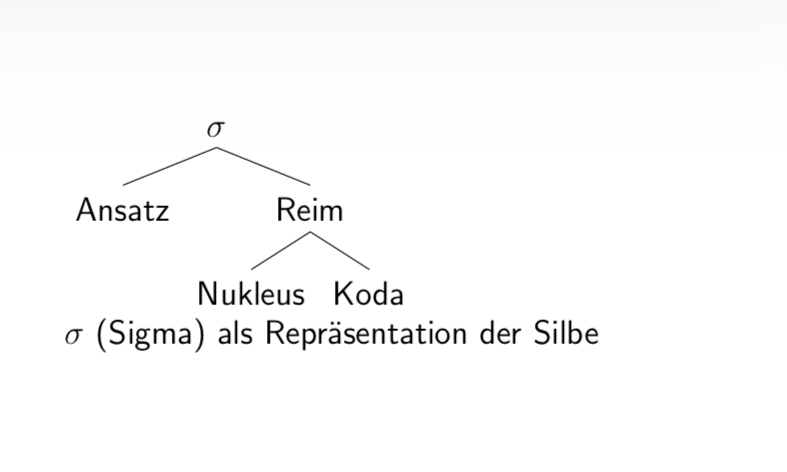
Konstituenten der Silbe
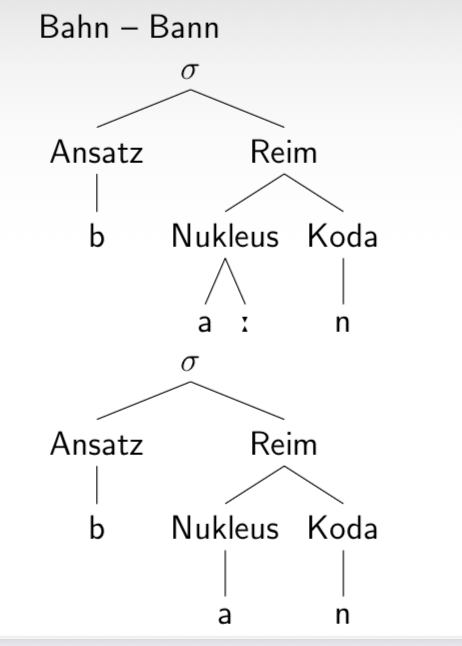
Konstituenten der Silbe
Bahn-Bann
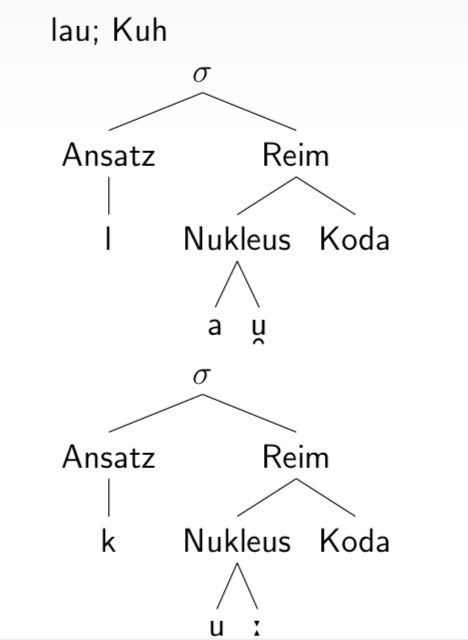
Konstituenten der Silbe
Lau;Kuh
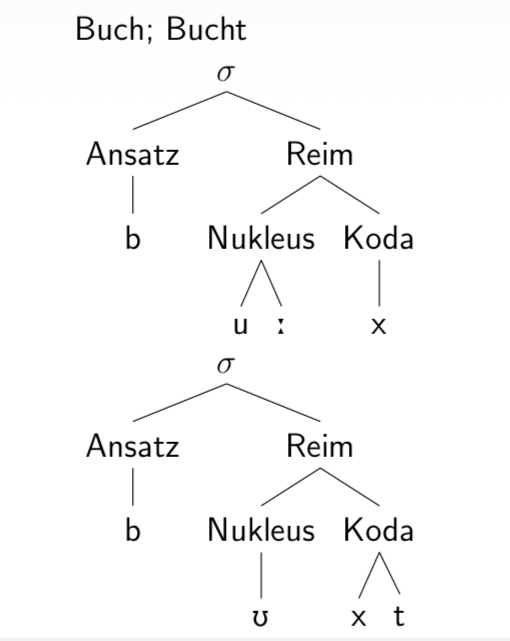
Konstituenten der Silbe
Buch;Bucht
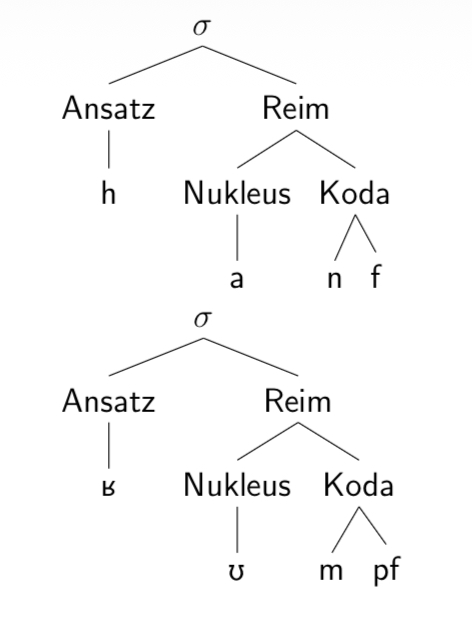
Komplexe Koda
Silben mit komplexer Koda verlangen einen einfachen
Nukleus (ungespannter Kurzvokal)!
Silben mit komplexem Nukleus verlangen keine oder
maximal eine einfache Koda!
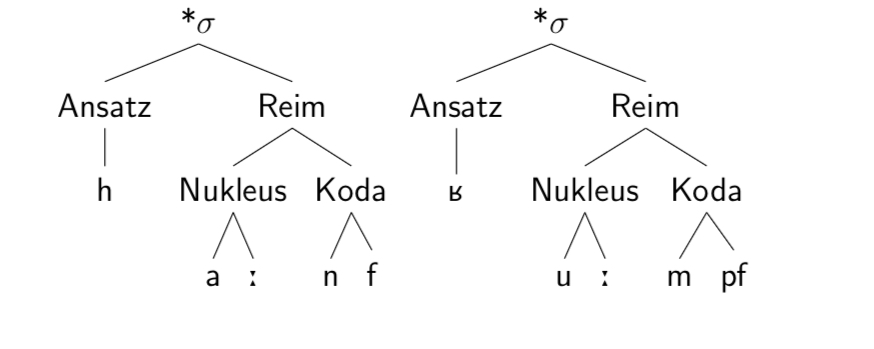
Komplexe Koda
Ausnahme: koronale Obstruenten ([s,t]) d¨ urfen im Reim von
Überkomplexen Silben stehen: Mond [mo:nt], Haupt [haUpt],
Jagd [ja:kt], Obst [Po:pst];
gilt oft für flektierte W¨ orter: (des) Arzts [Pa:Ktsts]; (du)
steigst [StaIkst]
43 / 70Rückblick Phonologische Prozesse Silbe
Silbenstruktur
Silben sollen einen Ansatz haben:
Glottalverschluss im Deutschen (beachten)
Liaison im Frz. (l’ami )
Assimilation/Resyllabifizierung: ve:k - ve:.g@, *ve:g.@
Prinzip der Ansatzmaximierung
Auch: Matrose: ma.tKo:.z@, *mat.Ko:.z@
Die einzige Ausnahme wären die zweiten Silben bei den
Eigennamen Bea und Theo.
Sonoritätsabfolgebeschränkung
Eine weitere Frage, mit der sich die Phonologie
beschäftigt, ist die Generalisierung über Segmentabfolgen
in der Silbe.
Der Nukleus ist das sonorste (das schwingendste)
Element, daher nennt man ihn auch Silbengipfel; zu den
Silbenrändern fällt die Sonorität ab.
Anders gesagt: Zunahme der Sonorität von den
Silbenrändern Richtung Nukleus.
Der Nukleus enthält meist einen Vokal, die Silbenränder
(Ansatz und Koda) sind mit Konsonanten besetzt.
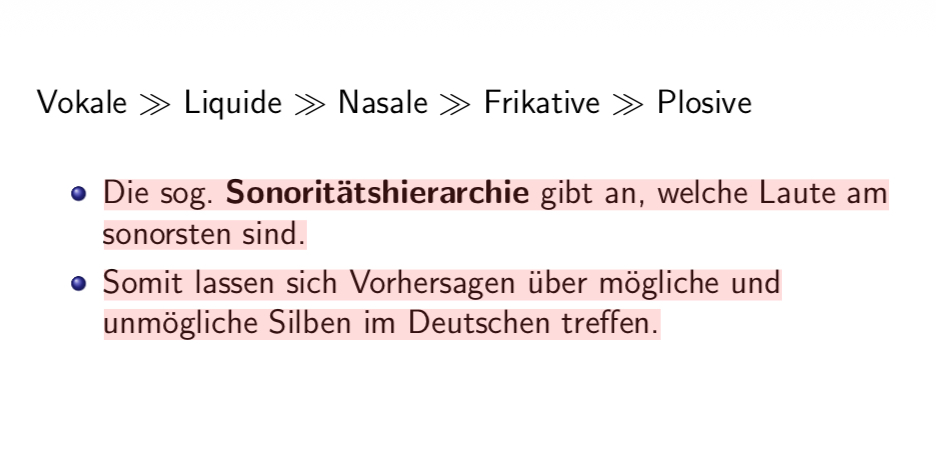
Sonoritätshierarchie
Die sog. Sonoritätshierarchie gibt an, welche Laute am
sonorsten sind.
Somit lassen sich Vorhersagen über mögliche und
unmögliche Silben im Deutschen treffen.
Komplexe Ansätze
Erlaubte komplexe Ansätze:
Obstruent-Sonorant (zunehmende Sonorität Richtung
Nukleus): Blau, Brief, Plastik, Prunk, dringend, Traum,
Glanz, grau, Klatsch, Flasche, frisch, Pflaume, Pfund,
schmollen, Schnuller, schlau, Strumpf,
Plosiv + Nasal selten: kn - knapp, Knatsch; gn - Gneis
(pn - Pneu)
Aber nicht erlaubt sind *dl,* tl
Ebensowenig *dorsaler Frikativ + Sonorant: *sn, *sl, *sm,
*fn, *fm
Komplexe Ansätze
Erlaubte komplexe Ansätze:
Plosiv-Frikativ (zunehmende Sonorität Richtung Nukleus)
pf - Pfau; ps - Psychologie; (pS - Pschorr);
ts - Zunder; Zuber
kf - Qual; ks - Xaver;
(d3 - Dschungel), alle anderen Plosiv-Frikativ-Abfolgen mit
stimmhaften Obstruenten sind ungrammatisch
Frikativ-Plosiv
(abnehmende Sonorit¨ at Richtung Nukleus) nur mit [s/S])
erlaubt
sk - Skat, Skelett, st - Stil
Sp - Spiel, St - Steuer, (Sk - Schkeuditz)
Komplexe Kodas
Bei den erlaubten komplexen Kodas ist es eben anders
rum:
Sonorant - Obstruent: stark, derb, Alk, Berg, Alb,
Bank, Lump, Sumpf, Ralf, Wurf, Hanf, M¨ onch, Bank,
halb
Hier auch: Liquid - Nasal: Wurm, Halm, Film, Harn
D.h. →In der Koda: Liquid vor Nasal vor Obstruent. Stl.
koronale Obstruenten beliebig.
Komplexe Kodas
Ebenso erlaubt in der Kodas sind Frikativ-Plosiv
ft - Haft; xt - acht, st - Ast, Mist
ks - Max
Aber im Deutschen i.d.R. nicht *fk,* sk - (aber engl. disk, ask,
deutsch: grotesk)
*fp,* sp - (aber engl. wasp, crisp), *Sp,*Sk
Weiterhin erscheinen dorsale Frikative nicht in komplexer Koda
nach Plosiv (vgl. franz. autre [o:tK]’andere(r)‘)
Affrikaten
Einige Plosiv-Frikativ-Kombinationen sind erlaubt: ps -
Raps; pS - hübsch.
Die Plosiv-Frikativ-Kombinationen [pf, ts, tS] (Topf, Hatz,
Matsch...) nennt man auch Affrikaten.
Affrikaten (Singular: die Afrikate) sind homorgan (mit
demselben Artikulator) gebildete Plosiv-Frikativ-Abfolgen.
Sie können sowohl im Silbenansatz, als auch in der Koda
vorkommen.
In der Koda verletzen Sie die
Sonoritätsabfolgebeschränkung, wenn man annimmt, dass
eine Affrikate aus zwei Segmenten besteht! →
entsprechend werden Affrikaten in manchen Darstellungen
als ein Segment gewertet (umstritten!!)
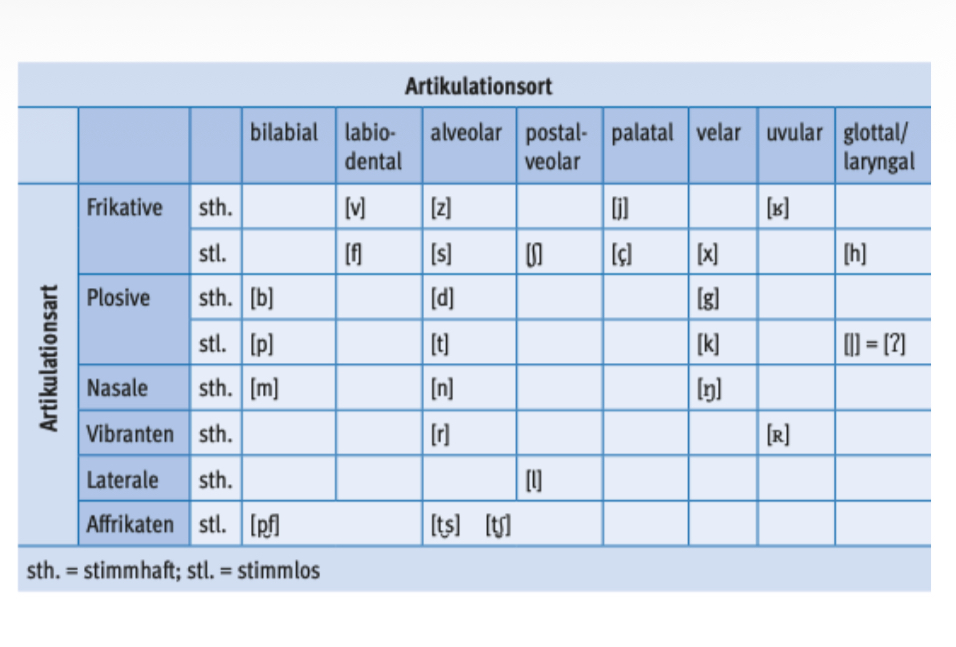
Konsonanten
Ambilsyllabizität
Manchmal ist es schwer, die Silbengrenze festzustellen.
Vergleiche: Kippe - [kIp@]; Kiepe - [ki:p@]
Ambilsyllabizit¨ at
Sprecherintuition: /p/ in Kippe ist gleichzeitig Koda der
ersten und Ansatz der zweiten Silbe. Aber Achtung: es
handelt sich nicht um eine Geminate wie in ital. citta.
/p/ ist hier ein Silbengelenk, da es Auswirkung auf zwei
Silben hat.
Daraus kann gefolgert werden: Betonte Silben m¨
ussen
mindestens zwei Reimpositionen besetzen: Langvokal oder
Kurzvokal mit Koda.
Außerdem: Silbengrenzen m¨ ussen nicht unbedingt
zwischen Segmentgrenzen stehen!
Hawaiianisch
In vielen Sprachen ist die Struktur der Silbe massiv
beschränkt.
Manche Sprachen erlauben keine Koda, z.B. das
Hawaiianische:
engl. ticket →haw.: kikiki
market →makeke
Japanisch
Das Japanische erlaubt (bis auf die Ausnahme /n/ sowie
Konsonantenverdoppelung (= Gemination)) keine Kodas.
Das führt zu Regelmäßigen KV, V oder KVV-Silben.
Dadurch kommt es zu kreativen Anpassungen von
Fremdw¨ ortern, z.B. Starbucks →jap. sut¯abakkusu
Oft wird der Vokal /u/ eingefügt, um eine konsonantische
Koda zu vermeiden und ein neues Segment (eine neue
Silbe, aber s. u.) einzubauen.
Wie nennt sich dieser Prozess?
Dabei handelt es sich um eine Epenthese, die EinfÜgung
eines Stützvokals!
Japanisch
Weiterhin interessant: Für das Japanische (und andere
Sprachen) wird statt der Silbe die Mora als kleinste
prosodische Einheit herangezogen.
Die Idee (aus der Musik) ist, dass jede Mora gleich lang
ist. Es gibt keine komplexen und einfachen Moren (oder:
Morae).
Gespannte Vokale und konsonantische Geminaten werden
damit aufgebrochen.
Vgl. jap. kekkon ’Hochzeit’, 2 Silben, aber 4 Moren:
ke-k-ko-n
Vokalharmonie
Manche Sprachen, z.B. das Türkische, zeigen sog.
Vokalharmonie. Dies ist eine Domäne für phonologische
Prozesse.
Dies sieht man u.a. bei der Pluralbildung.
Vgl. tür. /dal/ - /dallar/ ’Zweig’ - ,Zweige‘
Aber /diS/ - /diSler/ ’Zahn’ - ,Zähne‘
Das Pluralmorphem /lar/ steht nach hinteren Vokalen,
das Pluralmorphem /ler/ nach vorderen Vokalen.
VL2 CHECKLISTE
Die Unterschiede zwischen Phonetik und Phonologie
Phon, Phonem, Allophon
Phonologische Prozesse
Die Silbe
Sonorität
Graphematik vs Orthographie
Graphematik: Schriftsystem mit eigenen, sich spontan
innerhalb einer Sprachgemeinschaft herausgebildeten
Regularitäten
Orthographie: “richtiges Schreiben”; durch Institution
normierte Schrift, in amtlichen Regelwerken festgelegt
Dependenzhypothese
Abhängigkeit von der Lautsprache
Schrift ist ein sekundäres System, das auf Lautsprache
basiert. (‘Primat des Mündlichen’)
Es gibt viele Sprachgemeinschaften ohne eigene Schrift.
Man kann kompetenter Sprecher einer Sprache sein, ohne
ihre Schrift zu beherrschen.
Meist gibt es enge Bezüge zwischen Lautsprache und
Schrift, die Schrift dient also der Abbildung der
Lautsprache.
Umgekehrt kann man nicht kompetenter Schreiber einer
Sprache sein, ohne die anderen Komponenten der Sprache
(inkl. Phonologie) zu beherrschen.
Autonomie der Graphematik
Schrift entwickelt eigene Gesetzmäßigkeiten, unabhängig
von der Lautsprache:
Beispiele:
Großschreibung von Satzanfängen oder Nomen
Akronyme (Abkürzungen): Hier richtet sich die
Aussprache oft nach der Schrift (Buchstabennamen)
ARD, ZDF, C&A ...
Interdependenz
Gegenseitige Abhängigkeit von Laut- und Schriftsprache:
“synchrone Dominanz der gesprochenen über die
geschriebene Sprachform” (Glück 2010: 299)
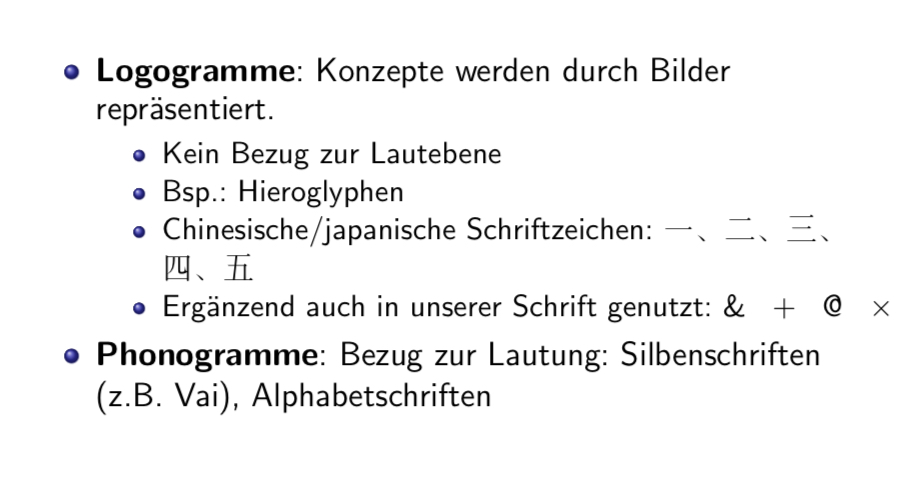
Logographisch vs phonographisch
Logogramme: Konzepte werden durch Bilder
repräsentiert.
Phonogramme: Bezug zur Lautung: Silbenschriften
(z.B. Vai), Alphabetschriften
Alphabetschriften
Alphabet- oder Segmentschriften
Beispiele: phönizisch (“Mutter” der Alphabetschriften),
griechisch, kyrillisch, lateinisch, hebräisch, arabisch,
georgisch, mongolisch ...
Enger Bezug zwischen Laut und Buchstabe
Alphabetschriften: flache vs tiefe Systeme
Flache Systeme: sehr enger Bezug zwischen Laut und
Buchstabe
Beispiele: Türkisch, Finnisch, Georgisch ...
Tiefe Systeme: unregelmäßige Beziehung zwischen Laut
und Buchstabe
Beispiele: Französisch, Englisch
Alphabetschriften: flache vs tiefe Systeme
Systeme, die heutzutage als “tief” gelten, waren fr¨ uher
“flache” Systeme.
Die Normierung der Schrift ¨ uber Dialektgrenzen hinweg
sorgt daf¨ ur, dass nur bestimmte Dialekte zum Standard
erhoben und dialektale Unterschiede nivelliert werden.
Norm gilt für lange Zeiträume, sodass spätere
Lautwandelprozesse nicht in die Schrift ¨ ubernommen
werden.
⇒Diskrepanz zwischen Lautung und Schreibung.
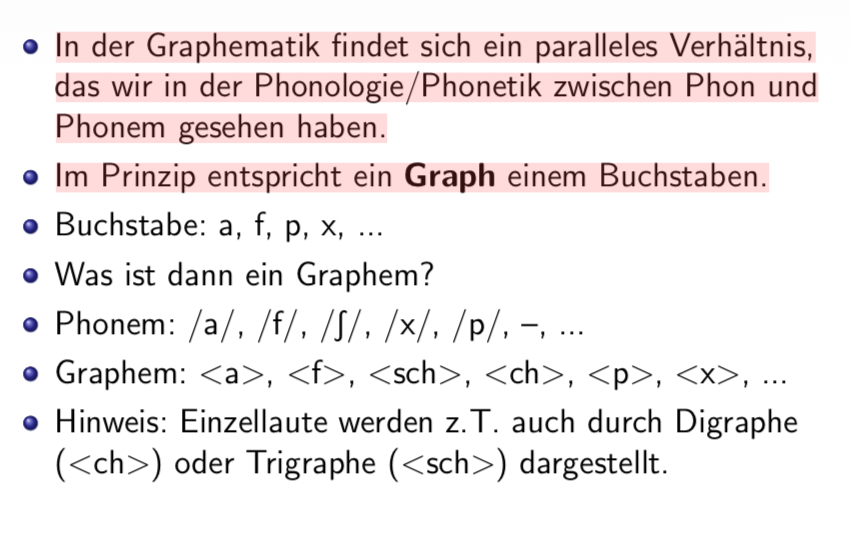
Graph und Graphem
In der Graphematik findet sich ein paralleles Verh¨ altnis,
das wir in der Phonologie/Phonetik zwischen Phon und
Phonem gesehen haben.
Im Prinzip entspricht ein Graph einem Buchstaben.
Graphem
Grapheme sind die schriftliche Entsprechung zu
Phonemen.
Sie werden in spitzen Klammern dargestellt.
So wie Phoneme die kleinste bedeutungsunterscheidende
Einheit der Lautsprache sind, sind Grapheme also die
kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten
der Schriftsprache.
Wie können wir dies nachweisen?
Auch hier gibt es Minimalpaare!
<kippen>– <wippen>
<kippen>– <kappen>
<kippen>– <kippel>
Allographen
Nicht in jedem Fall führt der Austausch von
Graphen/Buchstaben zu einer neuen Bedeutung:
<kühl>– <kuehl>
<draußen>– <draussen>– <drauszen>
Diese orthographisch zweifelhaften Schreibweisen sind in
manchen Kontexten durchaus angebracht (z.B.
Kreuzworträtsel). Es handelt sich um verschiedene
Realisierungsvarianten eines Graphems.
Analog nennt man sie Allographen.
Auch die Großbuchstaben (Majuskeln) werden als
Allographen aufgefasst. Großbuchstaben sind kontextuell
vorhersagbar (erster Buchstabe von Satzanfang und
Nomen) und müssen daher nicht extra gelistet werden
(vorausgesetzt die Zuordnung von Groß- zu
Kleinbuchstabe (Minuskel) ist bekannt).
Vokalschreibung
Es gibt (wenn man die Diphthonge mitzählt) über 20
Vokalphoneme, aber nur 8 Vokalbuchstaben.
Eine lautliche Unterscheidung, die nur mangelhaft in der
Schriftsprache abgebildet ist, ist die Vokalgespanntheit.
Die Unterscheidung zwischen Kurz- und Langvokal wird
in der deutschen Schrift nicht (nur) über den Vokal
selbst, sondern über den Kontext erzielt. Ggf. werden
Langvokale durch Dehnungzeichen markiert und
Kurzvokale durch Doppelkonsonanz.
Schärfung – Doppelkonsonanz
Schärfungsschreibung, Schreibgeminaten
markieren den vorangehenden Vokal als kurz/ungespannt
Für fast alle Konsonanten:
<p> Koppel, <b> Ebbe, <m> Flamme, <t> Kittel,
<d> Kladde, <n> Wanne, <s> lassen, <l> Halle,
<r> Karre, <g> Egge
Ausnahmen:
<h> *Ehhe
<ch> *Bechcher
<sch> *waschschen
<*kk> →<ck>
<*zz> →<tz>
Quantitätsbasierter Ansatz
Doppelkonsonanzschreibung markiert vorangehenden
betonten kurzen Vokal. Folgt nur ein Konsonant auf den
Vokal, wird dieser lang gesprochen; folgen mehrere
Konsonanten (oder eben eine konsonantische
Schreibgeminate), wird der Vokal kurz gesprochen.
Ausnahmen:
Lehn- / Fremdwörter: Job, Chip, Gag ... [dZOp, tSIp, gEk]
Funktionsw¨ orter: ab, mit, das ...
Silbenbasierter Ansatz
Doppelkonsonanzschreibung markiert ambisilbische (zwei
Silben) Konsonanten, und damit die Position der Vokale
(und Folgekonsonanten) in der Silbenstruktur.
[kIpe]– <kippe>
Wir erinnern uns: Der Konsonant [p] ist Silbengelenk
beim Wort Kippe. Er ist ambisilbisch (beiden Silben
zugeordnet), also gleichzeitig
1. Ansatz der zweiten Silbe (Prinzip der
Ansatzmaximierung) und
2. Koda der ersten Silbe (Reim einer betonten Silbe darf
nicht nur durch Kurzvokal besetzt sein)
Dehnung
Neben der Schärfung von Vokalen gibt es die Dehnung.
Diese kann ebenfalls durch verschiedene graphematische
Möglichkeiten realisiert werden.
Vokalverdoppelung
<aa> Saat, Waage, Paar, Aal
<ee> Beet, Fee, Allee, Meer, Schnee
<oo> Boot, Moor, doof, Zoo
<*ii>,<*uu>,<*ää>, <*öö>, <*üü>
Dehnungszeichen
<h> Naht, Reh, ihr, Mohn, Kuhle, M¨ ohre, k¨ uhl,
<e> Sieb, Lied, hier
<eh> Vieh, stiehlt
Rückblick Graphematik und Orthographie Sch
Schreibprinzipien
Schrift entspricht den Eigenschaften der Lautsprache in
unterschiedlicher Weise.
Das Wesen der Alphabetschrift ist, dass die Schrift die
Lautung anzeigt (phonographisches Prinzip).
Diesem Prinzip stehen allerdings andere Prinzipien
entgegen, was ggf. zu Konflikten führt:
Verwandte Wörter sollen möglichst ähnlich geschrieben
werden (morphologisches Prinzip).
Wenn möglich, soll die Wortherkunft erkennbar bleiben
(etymologisches Prinzip).
Das System soll trotz dieser konfligierenden Prinzipien
insgesamt möglichst einheitlich bleiben (ästhetisches
Prinzip).
Phonologische Schreibung
Idealfall der Alphabetschrift: 1:1 Beziehung zwischen
Lautung und Schreibung.
“Schreib wie Du sprichst!”
Dieses Ideal wird allerdings nie erreicht, weil andere
Prinzipien dem entgegenstehen.
Normproblem: Schrift ist meist konservativ, sie fixiert
Gedanken etc. unter Umst¨ anden für Jahrhunderte. Diese
Gedanken sollen lesbar bleiben. Sprachwandel im Bereich
der Phonologie wird nicht auf Schriftübertragen →
Diskrepanzen zwischen Lautung und Schrift.
Morphologisches Prinzip
Das morphologische Prinzip hat das Ziel die
verschiedenen Vorkommen eines Wortes gleich zu
schreiben (“Schemakonstanz”).
Dies führt zu unterschiedlichen Schreibweisen durch
Auslautverh¨ artung Kind:
[kInt]∼[kInd5]
<*kint> ∼<*kinda>
<kind> ∼<kinder>
Im Mittelhochdeutschen wurde die Auslautverh¨ artung
noch in der Schrift repr¨ asentiert: Z.B. wurde Tag als
<tac> verschriftlicht, aber Tage als <tage>.
Etymologisches Prinzip
Bei Entlehnungen aus bestimmten Prestigefremdsprachen
wird die Schreibung des Originals übernommen.
Philosophie, Phänotyp, Kalligraphie ...
Je länger, je häufiger ein Wort benutzt wird, desto stärker
wird die Schreibung angepasst.
In anderen Fällen völlige Anpassung: engl. cakes →dt.
Keks
Etymologisches Prinzip führt zu vielen Zweifelsfällen.
Asthetisches Prinzip
Dasselbe gilt für das ästhetische Prinzip, eine Triebfeder
für Rechtschreibreformen.
Viele Zweifelsfälle und Konflikte:
Kalligraphie, Phonologie ...∼?Kalligrafie, *Fonologie
aber: Fotografie, Telefon∼Photographie, Telephon
Mischformen innerhalb eines Wortes werden vermieden.
?Photografie, ?Fotographie
Andere ästhetische Schreibnormen:
Vor der letzten Rechtschreibreform wurde Schifffahrtneu
mit nur zwei aufeinander folgenden <f> geschrieben:
Schiffahrtalt
Weitere Prinzipien
Weiterhin soll die Schrift Bezug auf Wortarten und
Funktionen von W¨ ortern im Satz nehmen (syntaktisches
Prinzip).
Großschreibung kennzeichnet Substantive und das erste
Wort im Satz.
Ebenso: Zusammen- und Getrenntschreibung:
Dieses Wort wird zusammengeschrieben.
Hier wird auf einmal getrennt geschrieben.
Schließlich werden im Deutschen auch Anredepronomina
(Sie, Ihnen, ...) großgeschrieben (pragmatisches Prinzip).
VL3 CHECKLISTE
Begriffe: Phon, Phonem, Allophon, Graphem, Allograph
Darstellung: Phone in eckigen, Grapheme in spitzen
Klammern, Phoneme in Schrägstrichen
IPA (zumindest passives Verstehen)
verschiedene Realisierung von Konsonanten und Vokalen,
phonologische Prozesse, Verhältnis Sprache und Schrift
Flexion und Wortarten
flektierbar vs. unflektierbar
unflektierbar: Adverbien (hier, gestern...), Interjektionen
(ach, autsch, ups), Konjunktionen (und, oder, dass, weil,
wenn, obwohl), Partikeln (nur, ja, doch, je),
Präpositionen (auf, von unter)
flektierbar: Rest
konjugierbar (nach Tempus flektierbar) vs. deklinierbar
(nach Kasus flektierbar)
Verben sind konjugierbar
deklinierbar: Rest
mit festem Genus vs. nach Genus flektierbar
mit festem Genus: Nomen
nach Genus flektierbar: Rest
komparierbar vs. nicht komparierbar
Adjektive sind komparierbar, Pronomen nicht
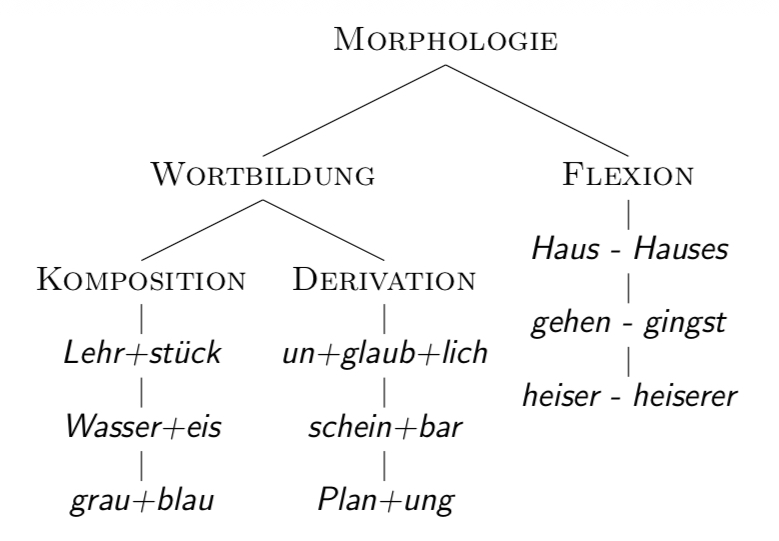
Teilgebiete der Morphologie
Derivation
Wir haben bereits gesehen, dass Derivationsmorpheme
neue Wortformen bilden.
Derivation: Bildung neuer Lexikoneinträge (auch:
Lemmata, vgl. Begriff Lexeme als Inhaltsmorpheme)
durch Affixe, möglicherweise mit Änderung der Wortart
des Stamms
Unterschied zu Flexion: neues Wort, nicht neue Wortform!
Unterschied zur Komposition: Beteiligung von
gebundenen, nicht-lexikalischen Morphemen
Derivation
Mit Wortartänderung
1 1. Gesetz - gesetzlich
2 2. Zweifel - zweifelhaft
3 3. zerstören - Zerstörung
2 4. Ohne Wortartänderung
1 1 kaufen - verkaufen
2 Busch - Geb¨ usch
3 Frau - Frauchen
Derivationsaffixe
Derivationsaffixe sind nicht beliebig mit Stämmen
kombinierbar.
Es gelten semantische, morphologische und phonologische
Beschränkungen!
*gr¨ un-bar,* heiter-ung,* such-lich,* zer-Wald,
*gestern-schaft
Warum sind diese W¨ orter nicht wohlgeformt?
Derivationsaffixe
Derivationsaffixe sind nicht beliebig mit Stämmen
kombinierbar.
Morphologische Beschränkung:
-bar verbindet sich in der Regel mit Verben. Die
entstehenden Adjektive sind also Deverbativa
verwertbar, brauchbar, auffindbar, zahlbar...
-heit/-keit verbindet sich mit adjektivischen Stämmen
(diese Wörter sind also Deadjektiva). Es entstehen
Nomen.
Offenheit, Stummheit, Schönheit, Gewandheit, ...
Sauberkeit, Verwertbarkeit, Zählbarkeit, Väterlichkeit, ...
Derivationsaffixe
Beschränkung nach Herkunft (nativer vs. fremder Stamm)
akzeptabel, profitabel, rentabel
*annehmabel,* verwertabel
Ist dieses Bildungsmuster produktiv? Kennen Sie weitere
Wörter mit -abel?
Derivationsaffixe
Beschränkung nach morphologischer Beschaffenheit der
Basis.
Zirkumfix Ge- -e nicht mit Partikelverben oder
präfigierten Verben!
Gerenne, Gehupe, Gesinge
*Geherumrenne,* Geanhupe,* Geverkaufe,* Gevergesse
Herumgerenne, Angehupe, *Vergekaufe,* Vergegesse
Derivationsaffixe
Beschr¨ ankung nach semantischen Eigenschaften der
Basis.
Ge- -e nicht mit statischen Verben!
Gerenne, Gehupe, Gesinge
Aber: Gewisse, Gekenne, Geheiße, Gewohne
Warum kann man mit wissen, kennen, heißen, wohnen
keine Ge- -e-Nominalisierung bilden?