Themenbereich 2 -> Hochbetagte Menschen pflegen
1/40
Earn XP
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |
|---|
No analytics yet
Send a link to your students to track their progress
41 Terms
Was versteht man unter einem Prostatakarzinom?
Bösartiger Tumor
Ausgehend von den Drüsenzellen der Vorsteherdrüse
Häufigster bösartiger Tumor bei Männern
Meist bei über 65-Jährigen
Wasserlassen ist zunächst nicht beeinträchtigt
Welche klinischen Zeichen weißt ein Prostatakarzinom auf?
Anfangs nur sehr selten Beschwerden
Sexuelle Funktionsstörungen
Allgemeinbeschwerden
Symptome durch Metastasen
Beschwerden beim Wasserlassen
Welche Kurativen Therapien gibt es bei einem Prostatakarzinom?
Radikale Prostatektomie
Strahlentherapie
Perkutane Strahlentherapie
Brachytherapie, also Bestrahlung „von innen“
Welche Nebenwirkungen können im Laufe der Behandlung eines Prostatakarzinoms auftreten?
Inkontinenz und Erektionsstörungen
Reizung des Enddarms durch Strahlentherapie
Aufklärung immer wichtig!!
Pflegerische Beratung und psychoonkologische Betreuung im Rahmen eines Prostatakarzinoms
Krisenhilfe
Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung
Veränderungen des Körperbildes beachten
Umgang mit Therapienebenwirkungen erleichtern
Angebot, Lebenspartner/in in Beratung einzuschließen
Auswirkungen ansprechen → Kein Tabu!
Umgang mit Harn- und Stuhlinkontinenz beraten
Behandlungsmöglichkeiten aufklären (operative Reduktion des Brustdüsengewebes)
Körperliche Betätigung fördern
Kontakte vermitteln (Selbsthilfegruppen, …)
Welche Präventiven Maßnahmen helfen gegen Prostatakarzinome?
Normalgewicht anstreben, Übergewicht reduzieren
Mäßige bis starke körperliche Aktivität an mindestens fünf Tagen der Woche
Gesund ernähren mit reichlich pflanzlichen Produkten bei gleichzeitiger Reduktion tierischer Lebensmittel wie Fleisch, Milch und Milchprodukte
Alkoholkonsum reduzieren
Nicht rauchen
Was versteht man unter einem Ulcus Cruris?
Unterschenkelgeschwür ohne spontane Heilungstendenz
Überwiegend durch Gefäßerkrankungen (v.a. durch Venenerkrankungen)
Mit steigendem Lebensalter zunehmende Häufigkeit
Welche Einteilungen gibt es bei Ulcus Cruris?
Venöses Ulcus Cruris (flächiger, nicht sehr tiefer defekt)
Arterielles Ulcus Cruris (kleine, tiefe, defekte, häufig Nekrosenbildung)
Welche Aspekte gibt es im Rahmen einer erfolgversprechenden Behandlung eines Ulcus Cruris?
Erfolgsversprechend ist eine Behandlung, die an mehreren Punkten ansetzt:
Ursache: Venöse Ulcera → venöse Stauung reduzieren; arterielle Ulcera → arterielle Durchblutung verbessern.
Bei Diabetes mellitus normale BZ-Werte anstreben!
Wunde: Voraussetzungen schaffen, dass die Wundheilung einsetzen kann (Nekrose entfernen…)
Begünstigende Faktoren/Auslöser: Beseitigung von Störfaktoren (z. B. Druck, Wundinfektion, ungenügende Wundbehandlung, Mangelernährung etc.).
Was versteht man unter einer chronisch venösen Insuffizienz?
Eine Schädigung der Beinvenen, die den normalen Blutfluss verhindert
Welche Stadien gibt es bei einer chronisch-venösen Insuffizienz?
Stadium I: reversible Ödeme, Corona phlebectatica (erweiterte Hautvenen an den Fußrändern)
Stadium II: dauerhafte Ödeme, Hyper-/Pigmentierungen, Stauungsekzeme, Dermatoliposklerose (Fibrosierung des subkutanen Bindegewebes), Atrophie blanche (weißliche Hautareale)
Stadium III:
III a: abgeheiltes Ulcus cruris
III b: bestehendes Ulcus cruris
Welche klinischen Zeichen sind bei Lymphödemen bekannt?
Leitsymptome: Schwellung und Spannen der betroffenen Extremität
Typisch: weiches Ödem (Dellenbildung auf Druck)
Später: Haut wird härter, Hautveränderungen möglich
Stemmer’sches Zeichen positiv
Bei sekundärem Lymphödem: Beginn proximal
Welche Phasen der physiologischen Wundheilung werden unterschieden?
Exsudationsphase (Blutstillung, Gefäßverengung, Entzündungsreaktion, Reinigung)
Proliferationsphase (Granulationsgewebe, neue Gefäße/Zellen)
Regenerationsphase (Epithelisierung, Narbenbildung, Verschluss)
Ursachenbeseitigung bei Wunden
Hämatome entfernen (chirurgisch)
Nekrosen/Fremdkörper entfernen (Arzt)
Infektionen lokal/systemisch behandeln
Durchblutung verbessern
Einstellung bzw. Beseitigung der Grunderkrankung
Welche Maßnahmen helfen bei chronischem Schmerz?
Leitsymptome: Schwellung und Spannen der betroffenen Extremität
Typisch: weiches Ödem (Dellenbildung auf Druck)
Später: Haut wird härter, Hautveränderungen möglich
Stemmer’sches Zeichen positiv
Bei sekundärem Lymphödem: Beginn proximal
Wie läuft die Versorgung akuter Wunden ab?
Chirurgische Wundversorgung
Anamnese, Untersuchung, Vorbereitung
Reinigung, ggf. Nähen, Klammern
Pat. vorbereiten und informieren
Rechtzeitig schmerzmittel verabreichen
Was ist bei OP-Wunden zu beachten?
Gefahr: Infektion, Spannung, Exsudat
Drainage bei Bedarf
Verbandwechsel frühestens nach 24–48 h
Welche Vorbereitungen sind wichtig vor einer Wundversorgung?
Fenster und Türen schließen
Persönliche Schutzkleidung
Gute Beleuchtung
Hygienische Händedesinfektion
Mit kontaminierten Handschuhen nichts angreifen und verwendete Materialien sofort entfernen
Aufwendige Verbandwechsel evtl. in anderem Raum
Arbeitsfläche sauber
Materialien richten (steril/unsteril trennen)
Keine Materialien auf Patient ablegen
Wie ist die Vorgehensweise bei der Wundversorgung?
Bei Kindern: Materialien außer Sichtweite, Bezugsperson zum beruhigen
Alten Verband mit Einmalhandschuhen abnehmen
Haut/Wunde ggf. anfeuchten (z. B. mit NaCl-Lösung)
Tiefer liegende Tamponaden mit steriler Pinzette entfernen
Wunde inspizieren (Blut, Eiter, Beläge etc.)
Handschuhe wechseln, hygienische Händedesinfektion durchführen
Ggf. Abstrich entnehmen
Sterile Wundreinigung durch Spülung durchführen
Wundreinigung durch Wischen (nicht Tupfen), von innen nach außen)
Gereinigte Wunde beurteilen
Handschuhe wechseln, hygienische Händedesinfektion durchführen
Ggf. Klammern/Fäden ziehen mit sterilen Instrumenten
Einmalhandschuhe ausziehen und entsorgen
Phasen- und stadiengerechte Wundversorgung nach ärztlicher Anordnung durchführen
Wundverband fixieren
Welche Nachbereitung ist bei Wundversorgung wichtig?
Nachfragen, ob Verband bequem sitzt
Kinder loben
Pat. Informieren, dass bei Beschwerden meldet
Aufwurf Beutel verschließen und aus Zimmer bringen
Gebrauchte Instrumente Resterilisieren
Dokumentieren
Welche allgemeinen Richtlinien gibt es bei der Versorgung chronischer Wunden?
NaCl 0,9 % oder Ringerlösung als Spüllösung verwenden.
Antiseptika nur bei infizierten Wunden oder hohem Risiko!
Wundumgebung schützen, z. B. mit Zinkpaste.
Druckentlastung & Lagerung beachten.
Feuchtes Wundmilieu fördern.
Infektionen erkennen und behandeln.
Verbandwechsel individuell planen – häufig bei infizierten Wunden, seltener bei Granulation.
Wie kann man die Rezidivierung von Wunden behandeln?
Maßnahme | Ziel |
Ursachenanalyse (z. B. Druck, Durchblutung) | Risikofaktoren erkennen |
Schulung von Patient & Angehörigen | Eigenverantwortung stärken |
Hautschutz & Pflege | Barrierefunktion stabilisieren |
Kontrollierte Wunddokumentation | Frühzeitige Reaktion bei Verschlechterung |
Maßgeschneiderte Therapieplanung | Nachhaltige Wundheilung |
Infektionsvermeidung | Keine erneute Wunddehiszenz |
Druckentlastung & Lagerung | Rezidivprophylaxe bei Dekubitus & Ulcus |
Welche Maßnahmen werden bei Blutungen durchgeführt?
Kompression mit NaCl-getränkter Kompresse
Kühlung (Vasokonstriktion)
Blutstillung lokal durch z. B. Adrenalin, Hämostyptika
Arzt benachrichtigen bei stärkeren Blutungen
Was versteht man unter COPD und Exazerbation?
COPD (chronic obstructive pulmonary disease):
Atemflussbehinderung (nur teilweise reversible und über die Jahre meist verschlechternd)
Im fortgeschrittenen Stadium: Lungenemphysem unterschiedlicher Ausprägung
Exazerbation:
Sich häufende akute Verschlechterungen
Oft ausgelöst durch Infekte
Unmittelbar bedrohlich
Erhöhtes Risiko für zukünftige Verschlechterungen
Welche Ursachen gibt es für COPD und Exazerbation?
Multifaktoriell bedingt (genetisch & Umweltfaktoren)
Wichtigster Faktor: Rauchen (ist zu 80-90% die Ursache)
Rauchen oder andere eingeatmete Schadstoffe führen zu chronischen Atemwegsveränderung und übermäßiger Schleimproduktion der kleinen Atemwege → Verengung
Im Verlauf immer weniger reversibel
Durch entzündungsbedingtes Enzymungleichgewicht: Lungengewebe wird zerstört und Lungenemphysem bildet sich
Welche Symptome zeigen sich bei COPD?
Vorbote: chronische Bronchitis mit Husten & schleimigem (v.a. morgendlichem) Sputum (→ sog. Raucherhusten)
Belastungsdyspnoe
AZ-Verschlechterung
Zyanose
AHA Symptome → Atemnot, Husten, Auswurf
Typisch für Emphysem: Fassthorax (Thorax wegen Lungenüberblähung in Einatmungszustand verharrt)
Was gibt es über die Atemtherapie bei COPD zu wissen?
Soll besonders die Ausatmung verbessern und das Sekret verflüssigen
Atemtherapie ohne und mit Atemtherapiegeräten: einfache Atemübungen, Kontaktatmung, PEP-Geräte/ausatmen gegen Widerstand, SMI-Trainer, CPAP-Atmung
Atemunterstützende- und erleichternde Positionierungen
Dehnlagerung
Kutschersitz
Sitzen mit abgestützten Armen
Sekretmanagement: ausreichend Flüssigkeit, Inhalationen, Abklopfen/Vibrationen, oszillierende PEP-Geräte, produktive Abhusttechnik, evtl. endotracheales Absaugen
Verbesserung der Oxygenierung durch Sauerstoffgabe oder Langzeit-Sauerstofftherapie
Pflegerische Betreuung bei COPD
Patientenbeobachtung: Vitalzeichen, besonders Atmung, Husten & Sekretion, Bewusstsein, Hautfarbe
Unterstützung des Patienten bei Lebensaktivitäten (Erhalt von Ressourcen)
Anleitung zu korrektem und konsequentem Umgang mit Aerosolen und Inhalationen
Maßnahmen zur Vermeidung einer Infekt bedingten Exazerbation
Ernährung: Reduktion Übergewicht, Vermeidung Untergewicht
Motivation regelmäßige Bewegung, Physiotherapie, Teilnahme an Lungensportgruppe
Warum muss man bei COPD mit der Sauerstoffgabe aufpassen
Wenn der Körper über längere Zeit zu viel CO2 hat (das ist das Gas, das wir ausatmen), gewöhnt er sich daran. Der natürliche Antrieb zum Atmen, der normalerweise durch zu viel CO2 im Blut ausgelöst wird, funktioniert dann nicht mehr richtig. Stattdessen atmet man nur noch, wenn der Sauerstoffgehalt im Blut zu niedrig ist. Wenn wir Sauerstoff zuführen, um diesen niedrigen Sauerstoffgehalt zu korrigieren, entfällt dieser natürliche Antrieb zum Atmen. In der Folge wird die Atmung oberflächlicher bis hin zum Atemstillstand. Trübt der Pat. Im Verlauf einer Sauerstofftherapie ein und verändert seine Atmung, muss der Sauerstoff sofort unterbrochen und ein Arzt informiert werden!
Welche Formen von Demenz werden unterschieden?
Primäre Demenz (durch direkte Hirnschädigung)
Sekundäre Demenz (andere Krankheiten liegen der Demenz zugrunde)
5 Zentrale Hauptaussagen aus dem Konzept nach Tom Kitwood zu den Bedürfnissen dementiell erkrankter Menschen
Trost: Demente brauchen jemanden der sie annimt, versteht und Sicherheit gibt
Bindung: Personen ändern sich, wenn sie wichtige Bindungen verlieren
Einbeziehung: Jeder Mensch braucht soziale Kontakte
Beschäftigung: Demente beschäftigen, aber nicht überfordern
Identität: kann durch Biographiearbeit erhalten bleiben
Maßnahmen für die Kurzzeitpflege von Dementen im Pflegeheim
Fremdanamnese mit Angehörigen
ROT (große Uhren, Jahreszeitenkalender ...)
Toilettentraining
Zimmergestaltung (mit persönlichen Gegenständen, Fotos, eigene Bettwäsche, eigene Pflegeutensilien, etc….
Musik
Beschäftigungsmöglichkeiten (Spaziergänge, Dekorieren, …)
Piktogramme (Toilette zb. Herz an der Tür, Hinweis an Zimmertür)
Gedächtnistraining
Keine Reizüberflutung
Tag-Wach-Rhythmus
Orientierungshilfen
Wenig Aufenthalt im Zimmer
Viel Beleuchtung wegen der Orientierung
Wie setzt sich Validation zusammen?
trägt zum Wohlbefinden bei
trägt zur Lösungsfindung bei
wertschätzender Umgang
kann in tägliche Arbeit mit eingebunden werden
eigene Gefühle reflektieren, damit wertfrei validiert werden kann
Gefühle des Gegenübers wahrnehmen (sind richtig)
Augenkontakt, auf Augenhöhe
W-Fragen, außer Warum? (Warum-Fragen fordern auf zur Rechtfertigung.)
einfache/kurze Sätze
In den Schuhen des anderen gehen.
Kommunikationshilfen bei Menschen mit Demenz
Augenkontakt während Gespräch sowie auf Augenhöhe gehen, deutliche Aussprache, einfache Sätze
Patienten mit Demenz im Gespräch spiegeln; Wiederholen des Gesagten
Kein lautes Sprechen, ggf. Flüstern beruhigt eine aufgeregte Person
Vorbereiten bzw. vorinformieren von Pflegetätigkeiten
Authentizität der Pflegeperson während Gespräch, kein aufgesetztes Lächeln
Fragen einfach formulieren und keine Fragewörter wie z.B. Wieso, Warum -Fragen, gleiche Gestik und Mimik einnehmen, Sprache widerspiegeln, Berührung, wenn betroffene Person es zulässt
Welche Einflussfaktoren sind für Sturzrisiko bekannt?
Intrinsische Faktoren (Bsp. eingeschränkte Mobilität, Ängste, Beeinträchtigungen, Gang- und Gleichgewichtsstörungen, Gangunsicherheit, …)
Extrinsische Faktoren (Falsches Schuhwerk, Glatter Boden, Geringe Beleuchtung, …)
Die Risikoeinschätzung eines Sturzes wird in folgenden Situationen erhoben
In regelmäßigen Abständen, welche individuell mit dem Patienten festgelegt wurden
Immer bei folgenden Situationen:
Gesundheitszustand verändert sich
Pflegebedarf erhöht
Medikation geändert
Umgebung anders
Betroffene ist gestürzt
Welche Ursachen von Fieber werden unterschieden?
Infektiöses Fieber (bei Infekten)
Resorptionsfieber (Nach OP, Verletzungen, Verbrennungen, …)
Zentrales Fieber (bei Schädigung des Wärmeregulationszentrums)
Toxisches Fieber (Reaktion des Organismus auf körperfremdes Eiweiß nach Bluttransfusionen, Impfungen, …)
Fieber unbekannter Ursache
Welche Schweregrade werden bei Fieber unterschieden?
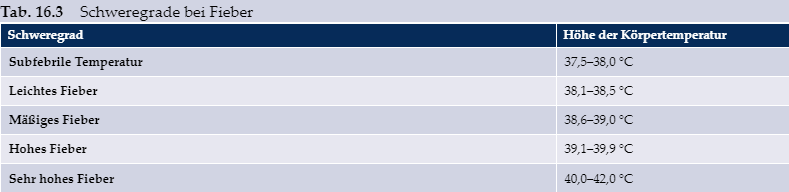
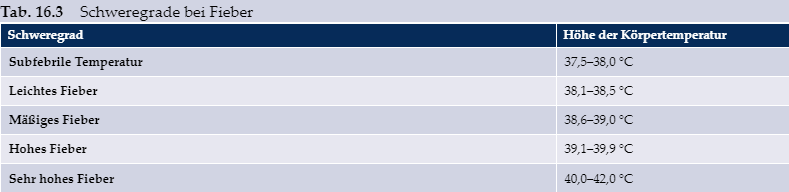
Welche Fieberphasen gibt es?
Fieberanstieg (Zittern, Schüttelfrost, …)
Fieberhöhe (glasige Augen, heiße trockene Haut, schnelle Atmung, …)
Fieberabfall (schwitzen, Wärmeabgabe vom Körper, Kollapsgefahr, …)
Welche pflegerischen Maßnahmen werden bei Fieber angewandt?
Raumtemperatur senken, Frischluftzufuhr, Zugluft vermeiden
Lockere Kleidung, Decken entfernen
Kühle Getränke, Waschlappen oder Waschungen vorbereiten
Fiebersenkende Wadenwickel/Arzneimittel nach Arztanordnung
Regelmäßige Vitalzeichenkontrolle durchführen
Auf Anzeichen der Exsikkose (Dehydratation achten
Flüssigkeitsbilanz anlegen
Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten
Energiezufuhr durch vitaminreiche, kohlenhydratreiche und fettarme Kost sichern
Auf regelmäßigen Stuhlgang achten
Maßnahmen der Thrombose- Pneumonie- /Dekubitusprophylaxe
Bei Patienten mit Diabetes mellitus: regelmäßige Blutzuckerkontrolle
Wie läuft eine fiebersenkende Körperwaschung ab?
Material
Waschschüssel mit Wasser
Zusätze, z. B. Pfefferminztee, Zitronensaft
Waschlappen
Handtuch
Durchführung
Wassertemperatur ca. 10 °C unterhalb der Körpertemperatur wählen und eventuell Zusatz hinzugeben
Pat. mit feuchtem Lappen zügig gegen Haarwuchsrichtung waschen
Feuchtigkeit auf Haut trocknen lassen, um Verdunstungskälte zu nutzen
Patient leicht zudecken zum Schutz vor Zugluft
Mehrmaliges Wiederholen der Waschung möglich