Einführung in das bürgerliche Recht new: 3
1/20
There's no tags or description
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |
|---|
No analytics yet
Send a link to your students to track their progress
21 Terms
2 Allgemeiner Teil des BGB
2.1 Personen und Sachen
1. Natürliche Personen (§ 13, § 14 BGB)
👉 Natürliche Personen = Menschen
Verbraucher (§ 13 BGB)
→ natürliche Person
→ handelt privat, nicht beruflichUnternehmer (§ 14 BGB)
→ natürliche oder juristische Person
→ handelt gewerblich/selbstständig
📌 Merke:
Verbraucher = privat
Unternehmer = beruflich/gewerblich (kann Mensch oder Firma sein)
2. Juristische Personen (§§ 21–89, 310 BGB)
👉 Juristische Personen = rechtlich anerkannte Organisationen, keine Menschen.
Beispiele:
Vereine
Stiftungen
Gesellschaften
Im BGB geregelt ist nur die GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)
Andere Gesellschaftsformen stehen in Sondergesetzen:
OHG → HGB
AG → AktG
GmbH → GmbHG
📌 Merke:
Juristische Personen handeln durch Organe (z.B. Vorstand) und können Verträge abschließen wie Menschen.
3. Sachen und Tiere (§§ 90–103 BGB) Sachen (§ 90 BGB)
👉 Definition: körperliche Gegenstände
→ alles, was man anfassen kann.
Tiere (§ 90a BGB)
Tiere sind keine Sachen
ABER: auf Tiere werden Sachenrecht-Regeln entsprechend angewendet
📌 Merke:
Tiere ≠ Sachen, aber rechtlich fast wie Sachen behandelt.
Abgrenzungsfragen
Verbraucher vs. Unternehmer: Prüfe, ob die natürliche Person überwiegend private oder geschäftliche Zwecke verfolgt
Natürliche vs. juristische Person: Nur natürliche Personen können Verbraucher sein; juristische Personen haben immer Unternehmereigenschaft
Sache vs. Tier: Tiere sind rechtlich keine Sachen, unterliegen aber sachenrechtlichen Regelungen analog
2 Allgemeiner Teil des BGB
2.2 Rechtsgeschäft, Willenserklärung und Vertrag
Das Rechtsgeschäft
Definition
Ein Rechtsgeschäft besteht aus mindestens einer Willenserklärung und soll die Änderung der Rechtslage herbeiführen.
Arten des Rechtsgeschäfts
Einseitiges Rechtsgeschäft: Besteht nur aus einer Willenserklärung (z.B. Kündigung).
Zweiseitiges Rechtsgeschäft: Besteht aus zwei sich entsprechenden Willenserklärungen (z.B. Vertrag, wie ein neuer Mietvertrag).
Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte (Abstraktionsprinzip)
Das deutsche Zivilrecht unterscheidet streng zwischen:
Verpflichtungsgeschäft schuldrechtlich, schafft die Pflicht zur Leistung, z.B. Kaufvertrag nach § 433 Abs. 1 BGB
Verfügungsgeschäft dinglich, bewirkt die unmittelbare Rechtsänderung, z.B. Übereignung der Sache nach § 929 Abs. 1 BGB
Diese Geschäfte sind rechtlich selbstständig und unabhängig (Abstraktionsprinzip).
Wichtig: Selbst wenn das Verpflichtungsgeschäft (Kaufvertrag) unwirksam ist, kann das Verfügungsgeschäft (Übereignung) wirksam bleiben. Eine Korrektur erfolgt dann über das Recht der ungerechtfertigten Bereicherung (§§ 812 ff. BGB).
Die Willenserklärung
Definition und Aufbau
Willenserklärung ist jede private Willensäusserung, die auf die Herbeiführung einer gesetzlich gewollten Rechtsfolge gerichtet ist. Sie ist Bestandteil jedes Rechtsgeschäfts.
Sie besteht aus:
Subjektiver Wille (innerer Tatbestand)
Objektive Erklärung (äußerer Tatbestand)
Grundsatz des Zugangs: Damit sie wirksam wird, muss sie dem Empfänger grundsätzlich zugehen (§ 130 BGB), d.h er muss Kenntnis bekommen (Ausnahmen: z.B. Testament).
Innerer Tatbestand (Subjektiver Wille)
Der innere Tatbestand gliedert sich in drei Elemente:
Element | Definition | Folge bei Fehlen |
Handlungswille | Das Verhalten ist willensgesteuert (kein Reflex). | Es liegt keine Willenserklärung vor. |
Rechtsbindungswille (Erklärungsbewusstsein) | Der Wille, "irgendwie rechtsgeschäftlich" zu handeln. | Es liegt keine wirksame Willenserklärung vor*. |
Geschäftswille | Der Wille, ein konkretes Rechtsgeschäft abzuschließen. | Es liegt eine wirksame Willenserklärung vor, die aber unter Umständen anfechtbar ist. |
*Die herrschende Meinung und Rechtsprechung differenziert hier präziser (Beispiel: Trierer Weinversteigerung).
Der Fall: Jemand winkt auf einer Weinversteigerung einem Freund zu, ohne zu wissen, dass Winken als Gebot gilt.
Die Lösung: Auch wenn das aktuelle Erklärungsbewusstsein fehlt, liegt eine Willenserklärung vor, wenn der Erklärende bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen können, dass sein Verhalten als WE gedeutet wird (potenzielles Erklärungsbewusstsein).
Konsequenz: Der Vertrag kommt zustande, aber der "Winker" kann wegen Irrtums (§ 119 BGB) anfechten.
Objektiver Tatbestand (äusserer Wille)
Die Erklärung kann entweder ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen.
Beispiele für konkludents Handeln: In den Bus einsteigen, Artikel auf die Kasse legen.
Jede Willenserklärung wird vom Empfänger „ausgelegt“. Massgeblich ist der objektive Empfängerhorizont, d.h.aus der Sicht eines verständigen objektiven Empfängers.
Beispiel:
Anton möchte auf dem Wochenmarkt Tomaten einkaufen. Am Gemüsestand bestellt er ein Dutzend Tomaten, in der irrigen Annahme, ein Dutzend seien 6 Stück. Muss Anton die 12 Tomaten abnehmen und bezahlen?
Ein Vertrag entsteht durch übereinstimmende Willenserklärungen (Konsens), wobei diese nach dem objektiven Empfängerhorizont (§§ 133, 157 BGB) auszulegen sind. Anton bestellt "ein Dutzend Tomaten", was ein objektiver Dritter – unter Berücksichtigung von Verkehrssitte und Sprachgebrauch – als 12 Stück versteht, da "Dutzend" standardmäßig 12 bedeutet. Antons subjektiver Irrtum (Annahme von 6 Stück) ändert nichts am objektiven Erklärungsgehalt, sodass ein wirksamer Kaufvertrag über 12 Tomaten zustande kommt.
Anton muss die 12 Tomaten aber nicht zwingend abnehmen. Da er sich über die Bedeutung des von ihm verwendeten Begriffs ("Dutzend") geirrt hat, liegt ein Erklärungsirrtum nach §119 Abs. 1 Alt. 2 BGB vor. Ein solcher Irrtum berechtigt Anton zur Anfechtung des Vertrages. Er muss die Anfechtungserklärung unverzüglich nach Kenntnis des Irrtums gegenüber dem Verkäufer abgeben. Bei erfolgreicher Anfechtung wird der Vertrag rückwirkend als von Anfang an nichtig, §142 Abs. 1 BGB betrachtet. Die Folge wäre, dass Anton die 12 Tomaten nicht abnehmen muss, er dem Verkäufer jedoch unter Umständen den entstandenen Vertrauensschaden nach §122 BGB ersetzen muss.
Der Vertrag
Die am Vertrag beteiligten Personen sind Gläubiger und Schuldner. Gläubiger ist derjenige, der einen Anspruch gegen die andere Vertragspartei, also gegen den Schuldner, hat. Schuldner ist somit derjenige, der dem Gläubiger etwas leisten muss.
Für einen wirksamen Vertrag müssen zwei übereinstimmende Willenserklärungen (Angebot und Annahme) vorliegen, §§ 145–153 BGB.
Das Angebot (Antrag) ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die inhaltlich auf den Abschluss eines konkreten Vertrages abzielt. Die Annahme muss durch ein einfaches “ja” erfolgen können.
Das Angebot ist bindend, §145 BGB.
Das Angebot erlischt wenn es vom Empfänger abgelehnt oder nicht rechtzeitig angenommen wurde, §146 BGB.
Die Annahme muss sich auf ein bestimmtes Angebot beziehen und dieses akzeptieren.
Eine verspätete Annahme gilt als neues Angebot, §150 Abs. 1.
Eine Annahme mit veränderten Bedingungen gilt als Ablehnung und neues Angebot, §150 Abs. 2 BGB
Zugang der Annahme kann entbehrlich sein, wenn eine solche Erklärung nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist, §151 BGB
Ein Vertrag kann nur dann zustande kommen, wenn Konsens vorliegt, d.h. wenn sich die Vertragsparteien über die wesentlichen Punkte des Vertrags einig sind.
Ob Angebot und Annahme übereinstimmen wird nach dem objektiven Empfängerhorizont beurteilt.
Dissens besteht wenn die Willenserklärungen nach der Auslegung nicht übereinstimmen. In diesem Fall wurde kein Vertrag geschlossen.
Im Zweifel gilt der Vertrag als nicht geschlossen, §154 Abs. 1 S. 1 BGB
Wenn die Parteien sich nicht bewusst sind dass sich über einen Vertragspunkt nicht geeinigt wurde (versteckter Einigungsmangel) gilt der Vertrag als geschlossen, sofern anzunehmen ist, dass der Vertrag auch ohne eine Bestimmung über diesen Punkt geschlossen sein würde, §155 BGB.
Gemäß §§ 133, 157 BGB sind Verträge nach Treu und Glauben auszulegen. Dies betrifft die Teile des Vertrages, die eine Lücke aufweisen. Bei der ergänzenden Vertragsauslegung ist vom objektiven hypothetischen Willen der Parteien auszugehen.
Bedeutung des Schweigens
Im normalen bürgerlichen Rechtsverkehr wird Schweigen i.d.R. als rechtliches Nichts betrachtet, §241a BGB.
Ausnahmen: Im Handelsrecht unter Kaufleuten bei regelmässigen Geschäften mit dem gleichen Vertragspartner.
2 Allgemeiner Teil des BGB
2.3 Die Geschäftsfähigkeit
Man unterscheidet zwischen drei Stufen der Geschäftsfähigkeit:
1. Volle Geschäftsfähigkeit
Definition: Volle Geschäftsfähigkeit tritt mit Vollendung des 18. Lebensjahres ein.
Dies ergibt sich aus dem Umkehrschluss zu den §§ 104 ff. BGB und der Definition der Volljährigkeit in § 2 BGB.
2. Geschäftsunfähigkeit
Wer ist geschäftsunfähig?
Kinder, die das siebte Lebensjahr noch nicht vollendet haben (§ 104 Nr. 1 BGB).
Personen, die sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden nicht nur vorübergehenden Zustand befinden (z.B. wegen Geisteskrankheit, § 104 Nr. 2 BGB).
Rechtsfolge: Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig (§ 105 Abs. 1 BGB). Ein Vertrag kommt niemals zustande.
Sonderfall: Auch Willenserklärungen, die in einem Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit (z.B. starke Trunkenheit) abgegeben werden, sind nichtig (§ 105 Abs. 2 BGB).
Hinweis: Volljährige Geschäftsunfähige können Geschäfte des täglichen Lebens tätigen, wenn die Leistung mit sofortigen Barmitteln bewirkt wird (sog. „kleine Alltagsgeschäfte" § 105a BGB).
3. Beschränkte Geschäftsfähigkeit
Wer ist beschränkt geschäftsfähig?
Personen, die mindestens sieben Jahre, aber noch keine 18 Jahre alt sind (Minderjährige gem. § 106 BGB).
Grundsatz: Der Minderjährige wird geschützt; Rechtsgeschäfte sind grundsätzlich nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters wirksam.
Ausnahmen (Rechtsgeschäft ist sofort wirksam):
Rechtlich lediglich vorteilhaftes Rechtsgeschäft:
Der Minderjährige erhält nur Rechte und geht keinerlei Verpflichtungen ein.
Es kommt nur auf den rechtlichen Vorteil an, nicht auf den wirtschaftlichen Vorteil (Bsp.: Kaufvertrag über eine Vespa ist nachteilhaft, da die Pflicht zur Kaufpreiszahlung entsteht).
Beispiele: Die Annahme einer Schenkung ohne Auflage (§ 516 BGB) oder der bloße Eigentumserwerb (Übereignungsvertrag nach § 929 BGB).
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (§ 107 BGB):
Die Einwilligung ist die vorherige Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.
Das Rechtsgeschäft ist von Anfang an wirksam.
Genehmigung des gesetzlichen Vertreters (§ 108 BGB):
Liegt keine Einwilligung vor, ist das Rechtsgeschäft schwebend unwirksam.
Die Wirksamkeit hängt von der nachträglichen Genehmigung des gesetzlichen Vertreters ab.
Bewirkung der Leistung mit eigenen Mitteln (sog. Taschengeld-Paragraph § 110 BGB):
Ein Vertrag, der rechtlich nicht nur vorteilhaft ist, ist trotzdem wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsgemäße Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung überlassen wurden (z.B. Taschengeld).
Achtung: Ratenzahlung oder künftiges Taschengeld zählen nicht als Bewirkung im Sinne des § 110 BGB
2 Allgemeiner Teil des BGB
2.4 Die Vertretung
📝 Zulässigkeit und Grundsatz der Vertretung
Grundsatz: Die Rechtsfolgen einer Willenserklärung treffen grundsätzlich denjenigen, der sie äußert.
Vertretung: Bei wirksamer Stellvertretung treffen die Rechtsfolgen nicht den Vertreter, sondern den Vertretenen, § 164 I BGB
Zulässigkeit: Vertretung ist grundsätzlich möglich.
Ausnahme (Unzulässigkeit): Nur bei höchstpersönlichen Rechtsgeschäften (z.B. Eheschließung, § 1311 BGB ist die Vertretung unzulässig.
🙋 Eigene Willenserklärung vs. Bote
Vertreter: Gibt eine eigene Willenserklärung ab. Die Regeln über die Willenserklärung (z.B. Anfechtung wegen Irrtum) werden auf die Person des Vertreters bezogen (Ausnahme bei der Zurechnung von Willensmängeln: § 166 I BGB).
Bote: Überbringt nur eine fremde Willenserklärung (wie ein "Tonband").
Geschäftsfähigkeit (§ 165 BGB): Auch ein beschränkt Geschäftsfähiger kann wirksam Vertreter sein, da ihn selbst kein rechtlicher Nachteil trifft (dieser trifft den Vertretenen).
👤 Handeln in fremdem Namen (Offenkundigkeitsprinzip)
Offenkundigkeitsprinzip (§ 164 I BGB): Der Vertreter muss erkennbar (ersichtlich) für einen anderen handeln. Der Geschäftspartner muss erkennen können, dass die Rechtsfolgen den Vertretenen treffen sollen.
Ausnahme: "Geschäft für den, den es angeht": Bei Bargeldgeschäften des täglichen Lebens (z.B. im Supermarkt), bei denen es dem Vertragspartner egal ist, wer sein Partner wird, kommt das Geschäft automatisch mit der Person zustande, "die das Geschäft angeht", ohne dass die Vertretung nach außen erkennbar sein muss.
Fehlende Offenkundigkeit: Handelt der Vertreter nicht erkennbar in fremdem Namen, gilt das Geschäft als Eigengeschäft des Vertreters (§ 164 II BGB), außer bei der o.g. Ausnahme.
Abgrenzung: Handeln unter fremdem Namen
Namenstäuschung: Der Handelnde tritt unter falschem Namen auf, aber dem Geschäftspartner kommt es auf den konkreten Namen nicht an → Eigengeschäft des Handelnden.
Identitätstäuschung: Der Geschäftspartner will gerade mit dem Träger dieses Namens abschließen.
Lag eine Vollmacht vor: Regeln der §§ 164 ff. BGB gelten entsprechend.
Lag keine Vollmacht vor: Regeln der §§ 177 ff. BGB gelten analog.
✍ Vertretungsmacht (Vollmacht)
Die Vertretung ist nur wirksam, wenn der Vertreter mit Vertretungsmacht gehandelt hat.
Arten der Vertretungsmacht
Gesetzliche Vertretungsmacht:
"Ob" und "Umfang" sind gesetzlich geregelt (z.B. (z.B. Eltern für Kinder § 1629 BGB ).
Rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht (Vollmacht):
Wird durch Rechtsgeschäft (Willenserklärung) erteilt. Die Erteilung ist grundsätzlich formfrei (§ 167 II BGB).
Arten der Vollmachtserteilung
Innenvollmacht (§ 167 I 1. Alt. BGB): Erklärung des Vertretenen gegenüber dem Vertreter.
Außenvollmacht (§ 167 I 2. Alt. BGB): Erklärung des Vertretenen gegenüber dem Vertragspartner.
Vollmacht durch Kundgebung (§ 171 BGB): Z.B. durch öffentliche Bekanntmachung (Eintragung der Prokura im Handelsregister).
Rechtsscheinvollmacht (Nicht gesetzlich geregelt)
Wird geprüft, wenn keine ausdrückliche Vollmacht erteilt wurde, aber der Anschein dafür erweckt wird.
Duldungsvollmacht: Der Vertretene kennt und duldet das Handeln des Vertreters.
Anscheinsvollmacht: Der Vertretene kannte das Handeln nicht, hätte es aber bei pflichtgemäßer Sorgfalt erkennen und verhindern können.
Folge: Vertretene muss das Geschäft gegen sich gelten lassen, da er für den geschaffenen Schein verantwortlich ist.
⚖ Rechtsfolgen der Vertretung
Wirksame Vertretung
Liegen alle vier Voraussetzungen vor (Zulässigkeit, eigene WE des Vertreters, Offenkundigkeit, Vertretungsmacht):
Der Vertrag kommt unmittelbar zwischen dem Geschäftspartner und dem Vertretenen zustande.
Rechte und Pflichten treffen den Vertretenen.
Fehlende Vertretungsmacht (Vertreter ohne Vertretungsmacht)
Der Vertrag ist für den Vertretenen zunächst schwebend unwirksam (§ 177 I BGB).
Genehmigung: Der Vertretene kann den Vertrag nachträglich genehmigen. Die Genehmigung wirkt rückwirkend (§ 184 I BGB).
Haftung des Vertreters (§ 179 BGB):
Kenntnis des Mangels durch den Vertreter | Haftung des Vertreters gegenüber dem Geschäftspartner |
Kannte den Mangel (§ 179 I BGB) | Wahlweise auf Erfüllung oder Schadensersatz. |
Kannte nicht den Mangel (§ 179 II BGB) | Nur auf Vertrauensschaden (Schaden, weil er auf die Vollmacht vertraute). |
Geschäftspartner kannte oder hätte kennen müssen den Mangel (§ 179 III BGB) | Keine Haftung des Vertreters. |
Unzulässige Vertretungen
Die Vertretung ist grundsätzlich unzulässig, wenn ein Interessenkonflikt des Vertreters vorliegt. Dies ist in §181 BGB geregelt und umfasst zwei Fälle:
1. Das Insichgeschäft (§181 1. Alt. BGB)
Definition: Der Vertreter schließt ein Rechtsgeschäft im Namen des Vertretenen mit sich selbst als Privatperson ab.
Beispiel: Der Geschäftsführer einer GmbH (als Vertreter der GmbH) zahlt sich selbst (als Privatperson) sein Gehalt aus.
Regel: Dies ist wegen des Interessenkonflikts grundsätzlich verboten.
2. Die Mehrfachvertretung (§181 2. Alt. BGB)
Definition: Der Vertreter schließt ein Rechtsgeschäft ab und vertritt dabei beide Parteien (z. B. Käufer und Verkäufer).
Regel: Auch hier besteht ein Interessenkonflikt, weshalb die Vertretung grundsätzlich unzulässig ist.
2 Allgemeiner Teil des BGB
2.5 Nichtigkeit von Rechtsgeschäften
1. Nichtigkeit aufgrund mangelnden Willensschutzes (Geheimer Vorbehalt, Scheingeschäft, Scherz)
Diese Fälle betreffen Situationen, in denen der innere Wille des Erklärenden nicht mit der nach außen kundgegebenen Erklärung übereinstimmt.
Grund | BGB-Vorschrift | Merkmale | Rechtsfolge |
Geheimer Vorbehalt | § 116 BGB | Eine Partei will die Erklärung insgeheim nicht. Der innere Wille ist unbeachtlich (Schutz des Empfängers). | Regel: Wirksamkeit. Ausnahme: Nichtig, wenn der Empfänger den Vorbehalt kannte. |
Scheingeschäft | § 117 BGB | Beide Parteien sind sich einig, dass die Erklärung nur zum Schein abgegeben wird (kein Rechtsbindungswille). | Nichtig (Scheingeschäft). Das verdeckte Geschäft ist wirksam, wenn es den Formerfordernissen genügt. |
Mangel der Ernstlichkeit | § 118 BGB | Die Erklärung wird nicht ernst gemeint und der Erklärende erwartet, dass der Empfänger dies erkennt (Scherzerklärung). | Nichtig. Der Empfänger hat ggf. einen Schadensersatzanspruch ("Vertrauensschaden" (negatives Interesse, § 122 BGB), wenn er die fehlende Ernstlichkeit nicht kannte oder kennen musste. |
2. Nichtigkeit aufgrund von Gesetzesverstößen und Formmängeln
Diese Nichtigkeitsgründe dienen dem Schutz der Allgemeinheit oder der Vertragsparteien.
Grund | BGB-Vorschrift | Kernpunkt | Beispiel |
Formmangel | § 125 BGB | Verstoß gegen eine gesetzlich oder vertraglich vorgeschriebene Form. | Grundstückskaufvertrag ohne notarielle Beurkundung (§ 311b BGB). |
Verstoß gegen Verbotsgesetz | § 134 BGB | Das Rechtsgeschäft verstößt gegen ein Gesetz, das seinen Inhalt verbietet. | Werkvertrag über Schwarzarbeit. |
Sittenwidrigkeit | § 138 BGB | Verstoß gegen das "Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden". | Überzogene Schmiergeldzahlung, Wucher (§ 138 Abs. 2 BGB). |
3. Nichtigkeit aufgrund von Anfechtung
Die Anfechtung führt zur rückwirkenden Nichtigkeit (§ 142 Abs. 1 BGB) und ist ein Gestaltungsrecht, das der Irrende oder Getäuschte geltend machen muss.
Gründe:
Irrtümer (§ 119 BGB).
Ein reiner Rechenfehler im Kopf ("verdeckter Kalkulationsirrtum") berechtigt nicht zur Anfechtung. Es ist ein unbeachtlicher Motivirrtum. Nur wenn die falsche Berechnungsgrundlage (z.B. Preis pro Stück) Teil der Erklärung wurde, kann man anfechten.Arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung (§ 123 BGB).
Wichtig: Die Anfechtung muss durch eine Anfechtungserklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner erfolgen (§ 143 BGB) und die Fristen sind zu beachten:
Irrtum (§ 119): Unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) nach Kenntnis des Irrtums (§ 121 BGB).
Täuschung/Drohung (§ 123): Innerhalb eines Jahres nach Entdeckung der Täuschung/Ende der Zwangslage (§ 124 BGB).
122 BGB (Schadensersatzpflicht) gilt auch bei der Anfechtung wegen Irrtums (§ 119 BGB)!
Wer sich irrt und anficht, muss dem anderen den Schaden ersetzen, den dieser hatte, weil er auf die Gültigkeit vertraut hat.
Ausnahme: Bei § 123 (Täuschung/Drohung) gibt es keinen Schadensersatz nach § 122, denn der Täuscher ist nicht schutzwürdig.
2 Allgemeiner Teil des BGB
2.6 Verjährung
1. Grundprinzip
Verjährung = Einrede, kein automatischer Anspruchsverlust → Der Schuldner muss sich darauf berufen (§ 214 BGB).
Der Anspruch besteht weiter, ist aber nicht mehr durchsetzbar.
Nur Ansprüche (Tun oder Unterlassen, § 194 BGB) verjähren – Eigentum verjährt nicht.
2. Regelverjährung
3 Jahre (§ 195 BGB).
Beginn: Jahresende, in dem
Anspruch entstanden +
Gläubiger Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis hat (§ 199 I BGB).
👉 Das nennt man die kenntnisabhängige Verjährung ab Jahresende.
Spätestens jedoch: 10 Jahre nach Entstehung (absolute Frist, § 199 IV BGB).
3. Wichtige Ausnahmen zur Regelverjährung Kurze Fristen
Kaufrecht (bewegliche Sachen): 2 Jahre (§ 438 I Nr. 3 BGB)
Bauwerke (Kauf & Werkvertrag): 5 Jahre (§ 438 I Nr. 2, § 634a I Nr. 2 BGB)
Längere Fristen
Grundstücksrechte: 10 Jahre (§ 196 BGB)
Herausgabe aus dinglichen Rechten, Erb- & Familienrecht, titulierte Ansprüche, Vergleich, Urkunde etc.:
30 Jahre (§ 197 BGB)
👉 Diese nicht regelmäßigen Verjährungsfristen beginnen grundsätzlich mit Fälligkeit (§ 200 BGB), NICHT mit Jahresende!
4. Hemmung vs. Neubeginn 🕒 Hemmung (§§ 203–211 BGB)
"Pause" der Verjährung – die Uhr stoppt und läuft später weiter.
Typische Beispiele:
Verhandlungen über Anspruch (§ 203 BGB)
→ Verjährung +3 Monate nach Ende der Verhandlungen.Höhere Gewalt, bestimmte familienrechtliche Situationen, etc.
🔁 Neubeginn (§ 212 BGB)
Uhr wird auf 0 gesetzt → Frist läuft komplett neu.
Nur bei:
Anerkennung des Schuldners (Abschlagszahlung, Zinsen, Sicherheit)
Vollstreckungshandlungen
5. Rechtsgeschäftliche Änderungen (§ 202 BGB)
Keine Verkürzung bei Vorsatzhaftung.
Keine Verlängerung über 30 Jahre hinaus.
Sonst: vertragliche Änderungen möglich.
6. Rechtsfolgen (§§ 214–218 BGB)
Verjährung → Schuldner darf Leistung verweigern (§ 214 I BGB).
Trotz Verjährung:
Aufrechnung ist möglich (§ 215 BGB)
Zurückbehaltungsrecht möglich (§ 215 BGB)
Rücktritt und Minderung sind unwirksam, wenn der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist (§ 218 BGB).
3 Allgemeiner Teil des Schuldrechts
3.1 Inhalt der Schuldverhältnisse
Leistungspflicht und deren Bestimmung
Die Leistungspflicht kann ein Tun oder Unterlassen sein. Zur Bestimmung der konkreten Pflicht gehst du in einer bestimmten Reihenfolge vor:
Vertragliche Vereinbarung
Besonderer Teil des Schuldrechts
Allgemeiner Teil des Schuldrechts
§ 242 BGB (Treu und Glauben).
Arten der Leistungsverpflichtung
Leistungsgegenstand: die versprochene Leistung, also etwa Arbeitsleistung (§ 611 BGB), Herstellung eines Werkes (§ 631 BGB), Kaufpreiszahlung (§ 433 II BGB).
Hauptleistungspflicht: zentrale Vertragspflicht, ohne die der Vertrag keinen Sinn hat; z.B. Kaufpreiszahlung beim Kauf oder Miete bei Vermietung.
Einmalige Leistung: typischer Kaufvertrag (z.B. Autokauf)
Dauerschuldverhältnis: regelmäßig wiederkehrende Leistung (z.B. Miete)
Stückschuld: ein individueller Gegenstand (z.B. gebrauchtes Auto)
Gattungsschuld: Gegenstand einer Gattung, mittlere Art und Güte (§ 243 I BGB); durch Konkretisierung wird daraus eine Stückschuld (z.B. bei Holschuld, sobald bereitgestellt).
Die Konkretisierung tritt in wenn der Schuldner seinerseits das zur Leistung Erforderliche getan haben muss.
Hol-, Bring- und Schickschuld
Holschuld: Schuldner muss Sache bereitstellen und anbieten (Leistungsort beim Schuldner)
Bringschuld: Schuldner muss Sache am Wohnsitz des Gläubigers anbieten (Leistungsort beim Gläubiger)
Schickschuld: Schuldner übergibt Sache an Transportperson (Leistungsort beim Schuldner)
Risiko: Geht die Sache unterwegs kaputt, muss der Schuldner bei der Schickschuld (im B2B/Privatbereich) meist nicht noch einmal leisten (§ 447 BGB), da er seine Leistungshandlung ja schon erbracht hat.
Nebenleistungspflichten
Pflichten, die das bestimmungsgemäße Verwenden der Hauptleistung ermöglichen:
Aufklärungspflicht: Gläubiger über nicht bekannte Gefahren oder Risiken informieren.
Auskunftspflicht: umfassende Information über relevante Umstände (z.B. bei Unternehmenskauf).
Mitwirkungspflicht: Unterstützung zur Nutzung der Hauptleistung.
Schutzpflichten: Sicherheit und Schutz von Personen, Eigentum und Vermögen des Gläubigers.
Leistungstreuepflicht: Vermeidung jeder Gefährdung des Vertragszwecks.
Leistungsort
Der Ort, an dem die Leistung zu erbringen ist, hängt von der Schuldform ab:
Schuldart | Leistungsort | Beispiel |
|---|---|---|
Holschuld | Wohnsitz des Schuldners | Einkauf beim Bäcker |
Bringschuld | Wohnsitz des Gläubigers | Lieferung von Heizöl |
Schickschuld | Wohnsitz des Schuldners | Versand eines Gemäldes |
Geldschulden sind ein besonderer Fall der Schickschuld, § 270 BGB.
Im Gegensatz zur normalen Schickschuld trägt der Schuldner das Verlustrisiko, bis das Geld beim Gläubiger ankommt (§ 270 Abs. 1 BGB:
Leistungszeit (§ 271 BGB)
Grundsätzlich ist die Leistung sofort fällig, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei Vereinbarung einer Leistungszeit kann der Gläubiger die Leistung vorher nicht verlangen, der Schuldner aber regelmäßig vorher leisten, solange kein besonderes Gläubigerinteresse entgegensteht.
Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB)
§ 242 BGB verpflichtet den Schuldner, seine Leistung nach Treu und Glauben und unter Berücksichtigung der Verkehrssitte zu erbringen. Viele Nebenpflichten werden daraus abgeleitet. Ergänzt wird dies durch § 241 II BGB: Gegenseitige Pflichten bestehen bereits vor der eigentlichen Leistung und beziehen sich z.B. auf Rücksichtnahme auf Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils.
3 Allgemeiner Teil des Schuldrechts
3.2 Verletzung von schuldrechtlichen Pflichten
Bei der Abwicklung von Schuldverhältnissen kann es dazu kommen, dass eine oder beide Leistungen überhaupt nicht oder schlecht erbracht werden. Diese Störungen in der Abwicklung eines Schuldverhältnisses nennt man Leistungsstörungen.
Eine solche Leistungsstörung kann durch eine Pflichtverlet zung von Seiten des Gläubigers oder Schuldners verursacht sein.
Für die Darstellung der einzelnen Pflichtverletzungen siehe das Flashcard-Set “Bürgerliches Recht Kapitel 3.3 Verletzung von schuldrechtlichen Pflichten”
3 Allgemeiner Teil des Schuldrechts
3.4 Schadensersatz
1. Funktion der §§ 249–254 BGB
Die §§ 249–254 BGB sind keine eigene Anspruchsgrundlage (!).
Sie regeln vielmehr wie und in welcher Höhe Schadensersatz zu leisten ist und ergänzen damit die anspruchsbegründenden Normen (z. B. §§ 280 ff. BGB bei Vertrag, §§ 823 ff. BGB bei Delikt).
2. Grundsatz der Naturalrestitution (§ 249 I BGB)
Der Schadensersatz soll grundsätzlich durch Naturalrestitution geleistet werden.
Ziel: Wiederherstellung des hypothetischen Zustands, der ohne das schädigende Ereignis bestehen würde.
3. Geldentschädigung (§ 249 II BGB)
Bei Verletzung einer Person oder Beschädigung einer Sache hat der Geschädigte ein Wahlrecht zwischen Naturalrestitution und Geldentschädigung.
Wird in Geld ersetzt, ist der Betrag maßgeblich, der zur Wiederherstellung notwendig ist (Abrechnung oft auf Gutachtenbasis).
Der Geschädigte muss das Geld nicht zwingend zur Reparatur verwenden und muss einen günstigeren Reparaturpreis nicht zurückerstatten.
🧮 Ermittlung des Schadens
4. Differenzmethode
Die gängigste Methode zur Ermittlung der Schadenshöhe ist die Differenzmethode (§ 249 I BGB).
Schaden = Hypothetischer Wert (ohne schädigendes Ereignis) minus Tatsächlicher Zustand (nach Ereignis) minus Zurechenbare Vorteile.
Anrechenbare Vorteile werden abgezogen, um eine Überkompensation (Besserstellung als zuvor) zu vermeiden.
5. Vermögens- und Nichtvermögensschaden
Art des Schadens | Merkmale | Ersatzfähigkeit |
Vermögensschaden | Materieller Art, wirtschaftlicher Nachteil. | Grundsätzlich ersatzfähig. |
Nichtvermögensschaden | Immaterieller Art (z. B. Ehre, Schmerz). | Nur in gesetzlich bestimmten Fällen Entschädigung in Geld (z. B. Schmerzensgeld nach § 253 II BGB). |
3 Allgemeiner Teil des BGB
3.5 Verschulden
1. Eigenes Verschulden (§ 276 BGB)
Hier geht es darum, wie der Schuldner selbst gehandelt hat. Man unterscheidet zwei Hauptformen:
Form | Definition | Merk-Formel |
Vorsatz | Handeln mit Wissen und Wollen. Der Täter weiß, dass es verboten ist, und will den Erfolg (den Schaden) herbeiführen. | "Ich weiß es & ich will es." |
Fahrlässigkeit | Das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. | "Ich habe nicht aufgepasst." |
Wichtig bei der Fahrlässigkeit:
Objektiver Maßstab: Es ist egal, ob der Schuldner persönlich unfähig, müde oder unkonzentriert war ("persönliche Schwächen entschuldigen nicht").
Vergleichsgruppe: Man vergleicht das Handeln mit dem eines gewissenhaften Menschen aus dem gleichen Kreis (z. B. "Wie hätte ein ordentlicher Arzt gehandelt?").
Grobe Fahrlässigkeit: Eine Steigerung. Hier wurde die Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt ("Das darf doch wohl nicht wahr sein"-Moment).
2. Fremdes Verschulden (§ 278 BGB)
Dies ist eine Zurechnungsnorm. Der Schuldner kann sich nicht herausreden, indem er sagt: "Das war ich nicht, das war mein Mitarbeiter."
Der Grundsatz: Wer einen anderen (einen sogenannten Erfüllungsgehilfen) einschaltet, um seine Pflichten zu erfüllen, haftet für dessen Fehler wie für eigenes Verschulden.
Voraussetzungen:
Bestehendes Schuldverhältnis.
Dritter handelt zur Erfüllung der Verbindlichkeit (nicht nur zufällig dabei).
Mit Wissen und Wollen des Schuldners.
Die "Falle" (Wichtig für Klausuren!): Der Sorgfaltsmaßstab richtet sich nach dem Schuldner, nicht nach dem Gehilfen.
Beispiel aus dem Text: Der Möbelspediteur haftet für den Fehler des Studenten, auch wenn man dem Studenten persönlich keinen Vorwurf machen kann. Der Spediteur schuldet "Profi-Sorgfalt", also muss auch sein Gehilfe so arbeiten.
3. Haftung OHNE Verschulden (Ausnahmen)
In diesen Fällen haftet der Schuldner, selbst wenn er weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt hat.
Garantiehaftung: Der Schuldner hat garantiert, dass eine Eigenschaft vorhanden ist. Fehlt sie, haftet er immer.
Beschaffungsrisiko (Gattungsschuld): Wer verspricht, eine nur der Gattung nach bestimmte Sache (z. B. "10 Tonnen Weizen", nicht "genau dieser eine Sack") zu liefern, haftet auch, wenn er die Ware nicht besorgen kann (selbst wenn er nichts dafür kann, dass der Markt leer ist).
Zusammenfassung für das Gedächtnis
§ 276 BGB: Vorsatz (Wissen & Wollen) und Fahrlässigkeit (Sorgfalt außer Acht lassen).
Objektivität: Persönliche Dummheit oder Ungeschicklichkeit schützt nicht vor Strafe (Fahrlässigkeit ist objektiv).
§ 278 BGB: "Wer fremde Hände nutzt, muss für sie haften wie für eigene Hände." (Der Maßstab des Chefs gilt für den Gehilfen).
Garantie & Beschaffung: Hier kommst du aus der Haftung nicht raus, auch wenn du "nichts dafür kannst".
3 Allgemeiner Teil des BGB
3.6 Rücktritt vom Vertrag
Siehe Flashcard-Set “Bürgerliches Recht Kapitel 3.3 Verletzung von schuldrechtlichen Pflichten, Kapitel 3.6 Rücktritt vom Vertrag”
3 Allgemeiner Teil des BGB
3.7 Erfüllung
Die Erfüllung ist der primäre Weg, ein Schuldverhältnis zu beenden und alle gegenseitigen Ansprüche zu tilgen.
1. Voraussetzungen der Erfüllung (§ 362 Abs. 1 BGB)
Damit eine Forderung als erfüllt gilt, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:
Bewirkung der geschuldeten Leistung: Es muss die Leistung erbracht werden, die tatsächlich geschuldet war (z.B. Übergabe des Kaufgegenstands oder Zahlung des Preises).
Dies umfasst sowohl die Leistungshandlung als auch den Leistungserfolg.
Spezialfall: Bei der Schickschuld genügt das rechtzeitige Versenden der Ware, um Verzug zu verhindern (die Leistungshandlung ist entscheidend).
An den Gläubiger: Die Leistung muss an den Gläubiger selbst oder seinen gesetzlichen bzw. bevollmächtigten Vertreter (§ 164 BGB) erfolgen.
Durch den Schuldner: Die Leistung muss durch den Schuldner erfolgen. Der Schuldner kann sich dafür auch einer anderen Person bedienen, muss aber klarstellen, dass diese Person seine Schuld erfüllt.
2. Rechtsfolgen der Erfüllung
Der Anspruch des Gläubigers auf die Hauptleistung erlischt.
Der Schuldner hat einen Anspruch auf eine Quittung (§ 368 BGB) oder die Rückgabe eines Schuldscheins (§ 371 BGB).
3. Erfüllungssurrogate (Ersatzmittel)
Wenn die ursprünglich geschuldete Leistung nicht erbracht wird, können bestimmte Ersatzleistungen oder andere Vorgänge das Schuldverhältnis ebenfalls erlöschen lassen oder die Erfüllungswirkung herbeiführen:
Surrogat | Regelung | Beschreibung |
Leistung an Erfüllung statt | § 364 Abs. 1 BGB | Der Gläubiger nimmt eine andere Leistung anstelle der geschuldeten Leistung zur Erfüllung an. Das Schuldverhältnis erlischt sofort mit der Annahme der Ersatzleistung. (Beispiel: Blauer Golf statt gelbem Golf). |
Leistung erfüllungshalber | § 364 Abs. 2 BGB | Der Schuldner geht eine neue Verbindlichkeit gegenüber dem Gläubiger ein (z.B. Übergabe eines Schecks). Das Schuldverhältnis erlischt erst, wenn der Gläubiger die neue Verbindlichkeit verwertet hat (z.B. den Scheck eingelöst und das Geld erhalten hat). |
Hinterlegung | §§ 372 ff. BGB | Der Schuldner hinterlegt die geschuldete Sache (Geld, Wertpapiere, Urkunden, Waren) bei einer öffentlichen Stelle. Voraussetzung: Gläubigerverzug oder Ungewissheit über den Gläubiger. Die Hinterlegung befreit den Schuldner von der Leistung. |
Aufrechnung | §§ 387 ff. BGB | Ein Gestaltungsrecht, mit dem zwei gleichartige (z.B. Geld gegen Geld) und wechselseitige Forderungen getilgt werden, soweit sie sich decken. Erfordert eine Aufrechnungslage und eine Aufrechnungserklärung (§ 388 BGB). Die Forderungen erlöschen rückwirkend zu dem Zeitpunkt, als die Aufrechnungslage eintrat (§ 389 BGB). |
Erlass | § 397 Abs. 1 BGB | Schuldverhältnis erlischt durch Vertrag zwischen Gläubiger und Schuldner, in dem der Gläubiger die Schuld erlässt. |
Vergleich | § 779 Abs. 1 BGB | Ein Vertrag, der einen Streit oder Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis durch gegenseitiges Nachgeben beseitigt und das alte Schuldverhältnis durch ein neues ersetzt. |
4 Besonderer Teil des Schuldrechts
4.1 Kaufvertrag
1. Allgemeines und Vertragspflichten
Definition: Ein gegenseitiger, rein schuldrechtlicher Vertrag. Er begründet lediglich Leistungspflichten (Verpflichtungsgeschäft).
Kaufgegenstand: Nicht nur Sachen (§ 90 BGB), sondern auch Rechte (z.B. Forderungen) und andere verkehrsfähige Vermögensgegenstände (z.B. Know-how, Elektrizität).
Formfreiheit: Grundsätzlich formfrei (mündlich, konkludent möglich). Ausnahme: Bei bestimmten Geschäften (z.B. Grundstückskauf, § 311b BGB) ist eine gesetzliche Form (z.B. notarielle Beurkundung) erforderlich, sonst ist der Vertrag nichtig (§ 125 BGB).
Wesentliche Pflichten (§ 433 BGB):
Verkäufer: Übergabe und Übereignung der Kaufsache frei von Sach- und Rechtsmängeln (§ 433 Abs. 1 S. 2 BGB).
Käufer: Zahlung des Kaufpreises und Abnahme der Kaufsache (§ 433 Abs. 2 BGB).
2. Abstraktionsprinzip
Der Kaufvertrag (Verpflichtungsgeschäft) ist streng getrennt von den Erfüllungsgeschäften (dingliche Geschäfte).
Im Beispiel des Schokoladenkaufs:
Kaufvertrag (Verpflichtung, Eigentum zu übertragen).
Übereignung der Schokolade (Erfüllung der Verkäuferpflicht).
Übereignung des Geldes (Erfüllung der Käuferpflicht).
Die Unwirksamkeit eines Rechtsgeschäfts (z.B. des Kaufvertrags) lässt die anderen (z.B. die Übereignung) grundsätzlich unberührt. Es kann aber ein Anspruch auf Herausgabe wegen ungerechtfertigter Bereicherung (§ 812 BGB) entstehen.
3. Gefahrtragung
Grundsätze allgemeiner Schuldrechtregeln mit Besonderheiten, z.B. bleibt der Kaufpreisanspruch trotz zufälligem Untergang der Sache nach Gefahrübergang bestehen (§§ 446, 447 BGB)
4. Mangelhaftigkeit (Sach- und Rechtsmangel)
a.Sachmangel (§ 434 BGB)
Ein Sachmangel liegt bei Gefahrübergang (grundsätzlich bei Übergabe, § 446 BGB) vor, wenn die Sache:
Nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat.
Sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet.
Sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet und nicht die Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen gleicher Art üblich ist und die der Käufer erwarten kann (inkl. Werbeaussagen).
Ein Montagefehler oder eine fehlerhafte Montageanleitung (sog. „IKEA-Klausel“) vorliegt.
Eine Falschlieferung vorliegt (§ 434 Abs. 5 BGB).
b. Rechtsmangel (§ 435 BGB)
Ein Rechtsmangel liegt vor, wenn Dritte Rechte an der Sache geltend machen können, die der Käufer im Vertrag nicht übernommen hat (z.B. die Sache gehört einem Dritten oder ist mit einem Pfandrecht belastet).
5. Gewährleistungsrecht bei Mängeln (§ 437 BGB)
Bei Mangelhaftigkeit stehen dem Käufer folgende Rechte zu, wobei er zuerst die Nacherfüllung verlangen muss (Vorrang der Nacherfüllung):
Siehe auch Flashcard Set “Bürgerliches Recht Kapitel 3.3 Verletzung von schuldrechtlichen Pflichten, Kapitel 3.6 Rücktritt vom Vertrag, Kapitel 4.1.6 Gewährleistungsrecht des Kaufvertrages”
Anspruch | Anspruchsgrundlage | Details |
Nacherfüllung | § 437 Nr. 1 i.V.m. § 439 BGB | Wahlrecht des Käufers: Mangelbeseitigung (Reparatur) oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Neulieferung). Verkäufer kann diese verweigern, wenn sie unmöglich oder mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist (§ 439 Abs. 3 BGB). |
Rücktritt | § 437 Nr. 2 i.V.m. §§ 440, 323, 326 Abs. 5 BGB | Nur möglich, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen, unmöglich oder unzumutbar ist. Führt zur Rückabwicklung des Vertrages. Ausschluss: Bei unerheblichen Mängeln (§ 323 Abs. 5 S. 2 BGB). |
Minderung | § 437 Nr. 2 i.V.m. § 441 BGB | Herabsetzung des Kaufpreises (statt Rücktritt). Die Voraussetzungen sind grundsätzlich wie beim Rücktritt, allerdings ist die Minderung auch bei unerheblichen Mängeln möglich. Die Minderung wird nach einer Formel berechnet. |
Schadensersatz | § 437 Nr. 3 i.V.m. §§ 440, 280 ff. BGB | Setzt grundsätzlich voraus, dass der Verkäufer den Mangel zu vertreten hat (Verschulden). Unterscheidung: Schadensersatz neben der Leistung (z.B. Mangelfolgeschäden wie das beschädigte Parkett) und Schadensersatz statt der Leistung (Schaden, der anstelle der mangelfreien Leistung entsteht, z.B. Reparaturkosten). |
Aufwendungsersatz | § 437 Nr. 3 i.V.m. § 284 BGB | Ersatz für freiwillige Vermögensopfer, die der Käufer im Vertrauen auf den Vertrag tätigt (z.B. Miete eines Anhängers). |
6.Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen (Mängelansprüchen)
Gewährleistungsansprüche des Käufers können durch Gesetz oder Vertrag ausgeschlossen sein.
Gesetzlicher Ausschluss
Der Käufer kann keine Mängelrechte geltend machen, wenn er den Mangel bei Vertragsschluss kannte (§442 BGB Abs. 1 S: 1 )
Bei grober Fahrlässigkeit kann er ebenfalls keine Mängelrechte geltend machen, es sei denn der Verkäufer hat den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit übernommen (§ 442 Abs. 1 S. 2 BGB).
Vertraglicher Ausschluss:
Verkäufer und Käufer können Gewährleistungsansprüche vertraglich ausschließen (durch Individualabrede oder Allgemeine Geschäftsbedingungen).
Unwirksamkeit des Ausschlusses (§ 444 BGB): Ein vertraglicher Ausschluss ist unwirksam, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschweigt oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.
7. Verjährung im Kaufrecht
Regelverjährung: Zwei Jahre (§ 438 I Nr. 3 BGB).
Dies gilt auch für Mängel an Grundstücken, allerdings sind hier die 30-jährige Verjährungsfrist des § 438 I Nr. 1 BGB (z. B. bei dinglichen Rechten Dritter) zu beachten.
Bauwerke: Bei Mängeln an einem Bauwerk beträgt die Verjährung fünf Jahre (§ 438 I Nr. 2 BGB).
Arglist: Wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde, verjähren die Mängelansprüche erst nach drei Jahren (§ 438 III BGB).
Beginn der Verjährung:
Die Verjährung beginnt mit der Ablieferung der Sache bzw. der Übergabe des Grundstücks (§ 438 II BGB).
4 Besonderer Teil des Schuldrechts
4.2 Dienstvertrag
1. Definition und Wesen (§ 611 BGB)
Der Dienstvertrag ist ein entgeltlicher Vertrag über die Leistung von Diensten.
Vertragsparteien:
Dienstverpflichteter: Verpflichtet sich zur Leistung der versprochenen Dienste.
Dienstberechtigter: Verpflichtet sich zur Zahlung der vereinbarten Vergütung.
Gegenstand: Dienste jeder Art (Tätigwerden, für das Geld bezahlt wird).
Inhalt und Umfang: ergeben sich primär aus den vertraglichen Vereinbarungen.
2. Abgrenzung zu anderen Vertragsarten
Vertragsart | Merkmal | Risiko | Beispiel |
Dienstvertrag (§ 611 BGB) | Geschuldet ist das bloße Bemühen/Tätigwerden. | Risiko beim Dienstberechtigten (Vergütung auch ohne Erfolg). | Niedergelassener Anwalt vertritt Mandanten (Erfolg vor Gericht nicht garantiert). |
Werkvertrag (§ 631 BGB) | Geschuldet ist ein konkreter Erfolg/Resultat. | Risiko beim Werkunternehmer (Geld nur bei Erfolg). | Handwerker repariert Heizung (muss danach funktionieren). |
Arbeitsvertrag (§ 611a BGB) | Sonderform des Dienstvertrags. Merkmal: Unselbstständigkeit, Weisungsgebundenheit, Eingliederung. | Arbeitgeber trägt wirtschaftliches Risiko. | Juristin ist fest in der Personalabteilung angestellt. |
Auftrag (§ 662 BGB) | Besorgung eines Geschäfts, aber unentgeltlich. | - | Freundschaftsdienst. |
Hauptpflichten der Parteien
Dienstverpflichteter:
Hauptpflicht: Erbringung der vereinbarten Dienste (grundsätzlich höchstpersönlich, § 613 BGB).
Nebenpflichten: Schutz- und Treuepflichten gegenüber dem Dienstherrn (§ 242 BGB).
Dienstberechtigter:
Hauptpflicht: Bezahlung der vereinbarten Vergütung (§ 611 BGB).
Fälligkeit: Grundsätzlich nach Erbringung der Leistung (§ 614 BGB).
Nebenpflichten: Schutzpflichten, insbesondere vor Gefahren der Tätigkeit (§ 618 BGB).
Wichtig bei Annahmeverzug: Befindet sich der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste im Verzug, muss er die Vergütung gemäß § 615 BGB trotzdem zahlen, ohne eine Nachleistung verlangen zu können
Pflichtverletzungen
Bei Verletzung der Hauptleistungspflichten (Dienste erbringen / Vergütung zahlen) gelten die allgemeinen Regeln über Leistungsstörungen (Allgemeiner Teil des Schuldrechts).
Bei Verzug der Annahme der Leistung aus § 615 BGB muss der Dienstberechtigte trotzdem die Vergütung bezahlen – und zwar, ohne dass der Dienstverpflichtete zur Nachholung der Dienste verpflichtet ist.
Beispiel: Verpasster Arzttermin
Bei Nicht- oder Schlechterfüllung der Dienste kann der Dienstberechtigte die Vergütung zurückhalten, bis die Leistung erbracht ist, § 614 BGB.
Haftung: Nur Arbeitnehmer (im Rahmen eines Arbeitsvertrages) genießen eine Haftungsprivilegierung (§ 619a BGB). Der Arbeitnehmer haftet nur dann nach § 280 BGB, wenn er die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Die Beweislast trifft hier den Dienstberechtigten, § 619a BGB.
Andere Dienstverpflichtete haften nach den normalen Vorschriften.
Beendigung des Dienstverhältnisses
Das Dienstverhältnis kann auf verschiedene Weisen enden:
Ablauf der Zeit: Bei befristeten Verträgen (§ 620 I BGB).
Erreichung des Zwecks: Bei zweckgebundenen Verträgen (§ 620 II BGB).
Tod des Dienstverpflichteten (automatisch).
Aufhebungsvertrag (einvernehmliche Beendigung).
Kündigung: muss schriftlich erfolgen, elektronische Form ist ausgeschlossen, § 623 BGB:
Ordentliche Kündigung: Nach den Fristen des § 621 BGB (bei Arbeitsverträgen § 622 BGB).
Fristlose Kündigung: Nur aus wichtigem Grund möglich (§ 626 I BGB).
Sonderfall § 627 BGB: Fristlose Kündigung jederzeit ohne wichtigen Grund bei Diensten, die besonderes Vertrauen erfordern (z.B. Ärzte, Rechtsanwälte).
4.3 Werkvertrag
Hauptmerkmale des Werkvertrages
Gegenstand: Die Er- oder Herstellung eines Werkes, d.h. eines bestimmten Arbeitsergebnisses oder Erfolgs (§ 631 BGB).
Parteien: Werkunternehmer (schuldet den Erfolg) und Besteller (schuldet die Vergütung und Abnahme).
Form: Grundsätzlich formfrei.
Beispiele: Bauen eines Sandkastens, Erstellung eines Gutachtens, Reparaturaufträge, Erstellung eines Datenverarbeitungsprogramms.
Pflichten des Werkunternehmers
Der Werkunternehmer ist die Person, die verspricht, ein bestimmtes Werk herzustellen.
Hauptpflichten
Herstellung des Werkes: Die Hauptpflicht ist die rechtzeitige Herstellung des versprochenen Werkes gemäß §631 Abs. 1 BGB.
Mangelfreiheit: Er hat das Werk so herzustellen, dass es der vereinbarten Beschaffenheit entspricht und mangelfrei ist. Dies bedeutet, dass er die anerkannten Regeln seines Faches beherrschen und einhalten muss.
Nebenpflichten
Der Unternehmer hat verschiedene Nebenpflichten gegenüber dem Besteller, wie z.B. Aufklärungs-, Prüfungs-, Schutz-, Obhuts- und Beratungspflichten.
Ein Beispiel hierfür ist die Pflicht, die Rechtsgüter des Bestellers bei der Erstellung des Werkes nicht zu beschädigen (etwa das Parkett beim Einbau eines Schranks).
Pflichten des Bestellers
Der Besteller ist die Person, die das Werk in Auftrag gegeben hat.
Hauptpflichten
Abnahme des Werkes: Die erste Hauptpflicht ist die Abnahme des Werkes gemä §§640,631 BGB. Die Abnahme umfasst die körperliche Entgegennahme und die Billigung des Werkes, welche ausdrücklich oder konkludent erfolgen kann. Bei nicht unwesentlichen Mängeln kann die Abnahme verweigert werden.
Zahlung der Vergütung: Die zweite Hauptpflicht ist die Zahlung der vereinbarten Vergütung (§§631,632 BGB). Unter bestimmten Umständen ist er auch zur Abschlagszahlung verpflichtet (§632a BGB).
Nebenpflichten
Er hat Aufklärungs-, Schutz- und Obhutspflichten.
Mitwirkungspflicht: Der Besteller ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit diese erforderlich ist, um dem Unternehmer die Herstellung des Werkes zu ermöglichen (§642 BGB). Dies ist eine Gläubigerobliegenheit, deren Verletzung zum Annahmeverzug führen kann (z.B. die Teilnahme an Anprobeterminen bei einem maßgeschneiderten Kleid).
Beendigung des Werkvertrages
Regelfall: Erfüllung (Herstellung des Werkes und Zahlung der Vergütung).
Kündigung durch den Besteller: Jederzeit möglich (§ 648 BGB). Der Unternehmer behält den Anspruch auf Vergütung, muss sich aber ersparte Aufwendungen anrechnen lassen.
Verjährung:
Gewährleistungsansprüche verjähren grundsätzlich in zwei Jahren (ab Abnahme des Werkes).
Bei Bauwerken oder Planungsleistungen dafür: fünf Jahre.
Werklieferungsvertrag (§ 650 BGB)
Inhalt: Lieferung einer herzustellenden oder zu erzeugenden Sache.
Rechtsfolge: Es gelten die Vorschriften des Kaufrechts, nicht die des Werkvertragsrechts (z.B. Herstellung und Lieferung einer Einbauküche).
4.4 Unerlaubte Handlung
Die unerlaubte Handlung ist in den §§ 823–853 BGB geregelt und begründet das sogenannte Deliktsrecht.
Zweck und Funktion
Schadensersatz: Das Deliktsrecht dient dazu, Ersatz für Schäden zu sichern und zu regeln, die jemand unabhängig von einer vertraglichen Beziehung der Parteien erleidet.
Gesetzliches Schuldverhältnis: Allein durch die Erfüllung eines Tatbestandes nach §§823 ff. BGB entsteht kraft Gesetz eine schuldrechtliche Beziehung zwischen den Parteien. Man spricht daher von "gesetzlichen Schuldverhältnissen".
Verhältnis zur vertraglichen Haftung
Anspruchskonkurrenz: Besteht zwischen den Parteien bereits eine vertragliche Beziehung (z.B. Kauf-, Miet-, Werkvertrag), tritt der deliktische Schadensersatzanspruch neben den vertraglichen Anspruch.
Doppelte Anspruchsgrundlage: Diese Konkurrenz kann wichtig sein, falls einer der Ansprüche nicht durchsetzbar ist (z.B. wegen abweichender Verjährungsfristen).
Ausschließliche Grundlage: Besteht keine vertragliche Beziehung, ist der deliktische Anspruch die einzige Anspruchsgrundlage für Schadensersatz.
Umfang des Schadensersatzanspruchs bei unerlaubter Handlung
Der Umfang des Schadensersatzanspruchs richtet sich primär nach den allgemeinen Regeln des Schuldrechts (§§ 249 ff. BGB).
Spezialregelungen: Die §§ 842–852 BGB enthalten spezielle Regelungen für die unerlaubte Handlung, die den allgemeinen Regeln vorgehen.
Differenzierung: Es wird unterschieden zwischen:
Sachschäden (§§ 848–851 BGB)
Personenschäden (§§ 842–846 BGB)
Besondere Ansprüche bei Personenschäden
Ansprüche des unmittelbar Geschädigten:
Schmerzensgeld: Gemäß § 253 Abs. 2 BGB wird bei einem durch unerlaubte Handlung entstandenen immateriellen Schaden (Nicht-Vermögensschaden) Schmerzensgeld geregelt.
Wichtig: § 253 Abs. 2 BGB ist keine eigene Anspruchsgrundlage, sondern regelt nur den Inhalt des Anspruchs. Die Anspruchsgrundlage selbst ist die Norm, deren Folge Schadensersatz ist (z.B. § 823 BGB).
Ersatzansprüche des mittelbar Geschädigten:
Geregelt in § 844 BGB.
Betrifft insbesondere die Pflicht zur Zahlung der Beerdigungskosten und die Pflicht zur Unterhaltszahlung (für Personen, denen der Getötete Unterhalt schuldete).
Verjährung von Ansprüchen aus unerlaubter Handlung
Regelmäßige Verjährung: Es gilt die regelmäßige Verjährungsfrist nach § 195 BGB, die drei Jahre beträgt.
Beginn der Verjährung: Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem:
Der Anspruch entstanden ist und
Der Geschädigte von Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat (§ 199 Abs. 1 BGB).
Sonderregelung: § 852 BGB enthält eine Sonderregelung für aus unerlaubter Handlung entstandene Herausgabeansprüche.
4.5 Ungerechtfertigte Bereicherung
Allgemeines zur ungerechtfertigten Bereicherung
Grundprinzip der Ungerechtfertigten Bereicherung
Zweck: Die §§ 812–822 BGB dienen dem Ausgleich nicht gerechtfertigter Vermögensverschiebungen.
Ziel: Rückabwicklung von Werten, die ohne rechtliche Grundlage erlangt wurden, um sie dem tatsächlich Berechtigten zurückzugeben.
Kein Schadensersatz: Es geht nicht darum, eine Vermögenseinbuße auszugleichen, sondern nur das "Zuviel" auf der Seite des Bereicherten (des Bereicherungsschuldners) zurückzugewähren.
Voraussetzung: Es muss eine Vermögensvermehrung (Bereicherung) beim Schuldner vorhanden sein, die ungerechtfertigt ist.
Wichtigste Unterscheidung
Kondiktion: Dies ist der Anspruch oder die Klage auf Herausgabe aus ungerechtfertigter Bereicherung.
Leistungskondiktion: Die Bereicherung wurde durch eine Leistung des Entreicherten erlangt (z.B. die Erfüllung eines unwirksamen Vertrages).
Nichtleistungskondiktion: Die Bereicherung wurde "in sonstiger Weise" erlangt (fällt unter das Tatbestandsmerkmal des § 812 BGB).
Beispiel und Abstraktionsprinzip
Klassischer Fall: Ein erfüllter, aber nichtiger Vertrag.
Beispiel: Käufer K erhält ein Buch von V (Erfüllung des Kaufvertrages). K ficht den Vertrag später erfolgreich an, wodurch der Kaufvertrag (das Verpflichtungsgeschäft) von Anfang an nichtig ist.
Folge: K hat das Buch ohne rechtlichen Grund erlangt (wegen des Abstraktionsprinzips ist die Übereignung selbst zwar wirksam, aber die rechtliche Grundlage dafür entfällt).
Rückabwicklung: V hat gegen K einen Anspruch aus §§ 812 ff. BGB auf Herausgabe des Buches.
Rechtsfolgen der ungerechtfertigten Bereicherung
Zunächst wird eine Rückabwicklung der Vermögensverschiebung durchgeführt.
Meistens erfolgt die Rückgabe des Erlangten gemäß §§ 812, 813, 816, 822 BGB. Dann ist der Umfang der Bereicherung leicht oder sogar gar nicht notwendig festzustellen:
Der Bereicherte muss das, was er erlangt hat, herausgeben, die sog. „Herausgabe in natura“.
Ist der Gegenstand aber zerstört oder ist eine Herausgabe gemäß § 816 BGB nicht möglich, weil die Verfügung dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, so ist der Umfang der Bereicherung festzustellen.
Umfang des Bereicherungsanspruchs
Grundsatz der Herausgabe (§ 818 Abs. 1 BGB)
Die Herausgabepflicht erstreckt sich nicht nur auf den ursprünglich erlangten Gegenstand (Bereicherungsgegenstand), sondern auch auf Folgendes:
Gezogene Nutzungen: Das sind die Früchte oder Vorteile, die aus dem Gegenstand gezogen wurden (z.B. Mieteinnahmen aus einer unberechtigt genutzten Sache).
Ersatzgegenstände: Was der Empfänger aufgrund des erlangten Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung des Gegenstandes erhalten hat (z.B. eine Versicherungsleistung).
Wichtig: Der durch Rechtsgeschäft erlangte Erlös (z.B. der Kaufpreis oder die Miete aus einem Weiterverkauf oder einer Vermietung) fällt nicht unter § 818 Abs. 1 BGB.
Wertersatzpflicht (§ 818 Abs. 2 BGB)
Ist die Herausgabe des Bereicherungsgegenstandes unmöglich, muss der Verpflichtete Wertersatz leisten.
Gründe für die Unmöglichkeit:
Die Beschaffenheit des Erlangten (z.B. bei der Nutzung einer Dienstleistung oder eines Rechts, wie im Beispiel mit der Markenrechtsverletzung).
Der Empfänger ist aus anderen Gründen außerstande, die Sache herauszugeben (z.B. weil die Sache zerstört wurde).
Wegfall der Bereicherung (Entreicherung) (§ 818 Abs. 3 BGB)
Die Pflicht zur Herausgabe (oder zum Wertersatz) ist ausgeschlossen, wenn der Empfänger nicht mehr bereichert ist.
Definition: Ein Wegfall liegt vor, wenn sich weder der Gegenstand noch dessen Wert im Vermögen des Empfängers befinden.
Beispiele für Entreicherung:
Verbrauch der Leistung (bei gegenständlichen Leistungen).
Schenkweise Weggabe an Dritte (wobei hier § 822 BGB zu beachten ist, der eine Herausgabepflicht des Beschenkten begründen kann).
Ausgabe von Geld für Dinge, die sonst nicht gekauft worden wären (z.B. eine Vergnügungsreise).
Kein Wegfall der Bereicherung (Bereicherung bleibt bestehen):
Aufwendungen: Der Empfänger hat durch die Leistung Kosten gespart, die er ohnehin gehabt hätte (z.B. Bezahlung von Miete oder notwendigen Lebensmitteln).
Anschaffung eines noch vorhandenen Gegenstandes.
Erlangung einer Forderung gegen Dritte.
Verschärfte Haftung
Zweck der verschärften Haftung
Grundidee: Der Gesetzgeber will verhindern, dass sich der Bereicherungsschuldner (derjenige, der etwas ohne Rechtsgrund erhalten hat) darauf verlassen kann, das Erlangte behalten zu dürfen.
Schutzbedürftigkeit: Seine Schutzbedürftigkeit ist in diesen Fällen vermindert.
Gesetzliche Verankerung
Die verschärfte Haftung ist insbesondere in folgenden Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) geregelt:
Paragraph | Auslöser der Verschärfung | Haftungsfolge |
§ 818 Abs. 4 BGB | Eintritt der Rechtshängigkeit: | Haftung nach den allgemeinenVorschriften (d.h. für Vorsatz und Fahrlässigkeit). |
§ 819 Abs. 1 BGB | Der Empfänger (Bereicherungsschuldner) hat tatsächliche Kenntnis vom Mangel des rechtlichen Grundes (Kenntnismüssen reicht nicht!). | Verschärfte Haftung tritt ein. |
§ 819 Abs. 2 BGB | Der Empfänger verstößt durch die Annahme der Leistung gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten. | Verschärfte Haftung tritt ein. |
§ 820 BGB | Bei Ansprüchen wegen Nichteintritts des bezweckten Erfolges (§ 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 BGB). | Verschärfte Haftung tritt ein. |
5.1 Besitz
Beitzer einer Sache ist wer die Sachherrschaft über die Sache ausübt.
Besitzschutz
Anton sieht das Fahrrad des Bernd vor dessen Haus stehen. Da er gerade kein eigenes Fahrrad hat,nimmt er das Fahrrad von Bernd an sich. Bernd sieht dies und verfolgt Anton. Darf Bernd, als er Anton eingeholt hat, sein Fahrrad wieder an sich nehmen?
Ja, Besitzkehr §858 Abs. 2 BGB verbotene Eigenmacht des Anton. Er nimmt das Fahrrad in Besitz, obwohl ihm dieses nicht zusteht. Er weiss dass er kein Besitzrcht hat.
Folge der verbotenene Eigenmacht, ist dass der tatsächliche Besitzer Bernd, berechtigt ist, sich den Besitz wieder anzueignen, unter Umständen auch mit Gewalt (Rechtfertigungsgrund)
Anton wurde auf frischer Tat ertappt, Angriff dauert noch an.
Hätte Bernd dies nicht direkt gemerkt und es erst später bemerkt, wäre es nicht erlaubt gewesen es ihm mit Gewalt wegzunehmen.
Dies müsste dann vor einem Zivilgericht ein Herausgabeanspruch eingeklagt werden.
Eigentümer hat volle Verfügungsgewalt über die Sache.Grenzen ergeben sich, wenn Rechtsgüter anderer Personen geschädigt werden.
Eigentum ist ein Grundgrecht, Artikel 14. Staat darf im Normalfall nicht auf Eigentum zugreifen.
Tiere sind keine Sachen, 90a BGB aber werden rechtlich gesehen wie Sachen behandelt.
Beispiel: Haftung bei Überfahren eines Tieres.
Autofahrer kann nicht strafrechtlich wegen Körperverletzung anklagen, sondern nur zivilrechtlich für fahrlässige Sachbeschädigung.
Eigentumserwerb möglich durch Rechtsgeschäft, §929 BGB also etwas kaufen, Schenkung ist ebenfalls möglich.
Aufgrund Gesetzes, z.B. Aufgabe nach 959 BGB. gutgläubiger Ewerb nach 10 Jahren.
Hoheitsakt, z.B. Zuschlag bei öffentlicher Versteigerung (nicht auf Aktionsplattformen wie Ebay)
Aufgabe des Eigentums z.B. Dinge auf Strasse stellen oder bewusst in Mülleimer werfen. Sache wird herrenlos-
Eigentümer-Besitzer Verhältnis
Gem. § 985 BGB kann der Eigentümer vom Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen, sofern dem Besitzer nach § 986 BGB kein Besitzrecht zusteht.
Es gibt Fälle in denen Eigentum und Besitz auseinander fallen z.B. Wohnungseigentümer vermietet Wohnung an Mieter. Der Mieter hat tatsächliche Sachherrschaft und ist Besitzer der Wohnung. Da der Vermieter keine Sachherrschaft über die Sache hat, darf er die Wohnung auch nicht einfach ohne Zustimmung des Besitzers betreten.
Erst wenn der Mitvertrag beendet ist hat der Mieter kein Besitzrecht ist. Dann kann der Eigentümer Herausgabe des Besitzes anhand einer Räumungsklage beim Gericht beantragen nach §985 BGB.
Allgemeines zum Besitz
1. Definition und Merkmale
Gesetzliche Grundlage: Der Besitz ist in den §§ 854 ff. BGB geregelt.
Definition: Besitz ist die von der Verkehrsanschauung anerkannte tatsächliche Herrschaft einer Person über eine Sache.
Tatsächlichkeit: Entscheidend ist die tatsächliche Herrschaft, nicht das Recht zum Besitz. Deshalb kann auch ein Dieb Besitzer sein.
Voraussetzungen (nach Rspr.): Es sind ein Besitzgründungswille, eine gewisse räumliche Beziehung zur Sache und eine gewisse Dauer dieser räumlichen Beziehung erforderlich.
Gegenstand: Nur Sachen können Gegenstand des Besitzes sein (nicht Personen, Arbeitskraft oder Geisteswerke).
2. Schutz, Verpflichtung und Bedeutung
Umfassender Schutz: Der Besitzer wird gesetzlich in vielfältiger Weise geschützt und berechtigt.
Schutz des rechtmäßigen Besitzes: Eingriffe können im Bereicherungsrecht abgewehrt werden (§812 I S. 1. 2. Alt. BGB).
Schutz des unrechtmäßigen Besitzes: Der unrechtmäßige Besitzer ist geschützt (§987 ff. BGB), wenn er unverklagt und redlich ist.
Verpflichtung: Der Besitzer kann zur Herausgabe verpflichtet sein (z.B. gegenüber dem Eigentümer nach §985 BGB).
Bedeutung für Dritte: Der Besitz kann Grundlage für einen gutgläubigen Erwerb sein (z.B. §1006 BGB).
Notwendiges Tatbestandsmerkmal: Die Übergabe des Besitzes ist eine notwendige Voraussetzung, insbesondere bei der Übereignung beweglicher Sachen (§929 S. 1 BGB).
3. Abgrenzung und Natur
Rechtsnatur: Der Besitz ist kein absolutes Recht, wird aber weitgehend wie ein dingliches Recht behandelt.
Übertragbarkeit/Vererblichkeit: Der Besitz ist übertragbar und vererblich.
Folge der tatsächlichen Natur:
Es gibt keine Anspruchsgrundlage für die spezifische Ausübung des Besitzes, sondern nur Vorschriften zum Schutz und zur Erhaltung.
Vorschriften über Rechtsgeschäfte (wie die Geschäftsfähigkeit) sind auf den Erwerb und Verlust von Besitz nicht anwendbar.
Die Arten des Besitzes
1. Unmittelbarer und mittelbarer Besitz
Unmittelbarer Besitz (§ 854 BGB)
Definition: Wer die tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache hat.
Erwerb:
Grundsätzlich durch Erlangen der tatsächlichen Gewalt (Sachherrschaft), was eine räumliche Beziehung und Einwirkungsmöglichkeit erfordert (originärer oder derivativer Besitz).
Erfordert den Besitzbegründungswillen (natürlicher Wille, nicht rechtsgeschäftlicher Wille).
Ausnahmsweise durch Rechtsgeschäft (§ 854 Abs. 2 BGB): Einigung und Aufgabe des Besitzwillens durch den Übertragenden, sowie Erwerbsmöglichkeit für den Erwerber.
Ende: Mit dem Verlust der Sache (§ 856 Abs. 1 BGB), egal ob willentlich oder unfreiwillig (z.B. Diebstahl).
Sonderfall Besitzdiener (§ 855 BGB): Eine Person, die die tatsächliche Gewalt in einem sozialen Abhängigkeitsverhältnis (z.B. Angestellte, Haushälterin) ausübt, ist nicht Besitzer. Besitzer ist allein der Besitzherr.
Mittelbarer Besitz (§§ 868 ff. BGB)
Definition: Derjenige, der den Besitz an einer Sache durch einen unmittelbaren Besitzer ausübt.
Voraussetzungen:
Bestehen eines Rechtsverhältnisses (§ 868 BGB) zwischen mittelbarem und unmittelbarem Besitzer (z.B. Miete, Pacht, Leihe).
Der unmittelbare Besitzer muss Fremdbesitzerwille haben (Willen, die Sachherrschaft für den mittelbaren Besitzer auszuüben).
Der mittelbare Besitzer muss einen durchsetzbaren Herausgabeanspruch gegen den unmittelbaren Besitzer haben.
Übertragung: Durch Abtretung des Herausgabeanspruchs (§ 870 BGB).
Ende: Wenn eine der Voraussetzungen wegfällt, z.B. durch Aufgabe des Fremdbesitzerwillens beim unmittelbaren Besitzer.
Beispiel: Mietvertrag
Unmittelbarer Besitzer: Der Mieter, da er die tatsächliche Sachherrschaft innehat und die Sache nutzt. Er besitzt sie mit Fremdbesitzerwille (er weiß, dass die Sache nicht ihm gehört).
Mittelbarer Besitzer: Der Vermieter (Eigentümer), der den Besitz durch den Mieter ausübt. Er hat gegen den Mieter einen Herausgabeanspruch (am Ende der Mietzeit).
2. Teil- und Vollbesitz
Teilbesitz (§ 865 BGB): Besitz an real abgrenzbaren Sachteilen (z.B. einzelne Zimmer in einer WG).
Vollbesitz: Alleiniger Besitz, d.h. niemand anderes hat ein Besitzrecht an einem Teil der Sache.
3. Allein- und Mitbesitz
Alleinbesitz: Besitz unter Ausschluss anderer Personen.
Mitbesitz (§ 866 BGB): Mehrere Personen besitzen eine Sache derart, dass jeder die ganze Sache besitzt, aber der Besitz durch den gleichartigen Besitz der anderen beschränkt ist.
Schlichter Mitbesitz: Jeder kann den Besitz allein ausüben (z.B. WG-Kühlschrank).
Qualifizierter Mitbesitz: Mitbesitzer können den Besitz nur gemeinschaftlich ausüben (z.B. Schließfach mit zwei verschiedenen Schlüsseln).
4. Eigen- und Fremdbesitz
Eigenbesitzer (§ 872 BGB): Wer den Willen hat, die Sache wie ein Eigentümer zu beherrschen. (Auch der Dieb kann Eigenbesitzer sein).
Fremdbesitzer: Wer den Willen hat, die Sache für einen anderen zu besitzen.
5. Rechtmäßiger und unrechtmäßiger Besitz
Rechtmäßiger Besitz: Besteht, wenn eine Berechtigung zum Besitz vorliegt (z.B. der Entleiher).
Unrechtmäßiger Besitz: Besteht ohne Berechtigung (z.B. der Dieb).
Der Schutz des Besitzes
Possessorischer Besitzschutz (§§ 858 ff. BGB)
Der possessorische Schutz schützt den Besitz als solchen, unabhängig von einem Recht zum Besitz (z.B. Eigentum). Er richtet sich primär gegen Verbotene Eigenmacht (§ 858 Abs. 1 BGB).
Grundprinzip: Schutz des Status Quo und Wiederherstellung der ursprünglichen Besitzlage. Es wird sofort reagiert, ohne die Frage des besseren Rechts (Eigentum, Mietvertrag etc.) zu prüfen.
Verbotene Eigenmacht (§ 858 Abs. 1 BGB): Entziehung oder Störung des unmittelbaren Besitzes ohne den Willen des Besitzers, es sei denn, das Gesetz gestattet es.
Fehlerhafter Besitz (§ 858 Abs. 2 BGB): Der durch verbotene Eigenmacht erlangte Besitz ist fehlerhaft.
Wichtig: Diese Fehlerhaftigkeit gilt nur im Verhältnis zwischen dem Geschädigten (bisherigem Besitzer) und dem Störer, nicht gegenüber Dritten (siehe Beispiel D stiehlt Uhr und verleiht an A).
Formen des Possessorischen Besitzschutzes
Selbsthilferechte (§§ 859, 860 BGB – "Gewaltrechte"):
Besitzwehr (§ 859 Abs. 1 BGB): Abwehr eines andauernden Angriffs auf den Besitz. Erlaubt ist nur die notwendige Gewalt zur Erhaltung des Besitzes.
Besitzkehr (§ 859 Abs. 2, 3 BGB): Wiedererlangung des Besitzes nach Entziehung.
Muss unverzüglich erfolgen ("auf frischer Tat" oder "unmittelbar nach der Entziehung").
Auch hier ist nur das absolut Notwendige erlaubt.
Besitzschutzansprüche (§§ 861 ff. BGB – "Klagerechte"):
Herausgabeanspruch (§ 861 BGB): Bei Entziehung des unmittelbaren Besitzes durch verbotene Eigenmacht.
Voraussetzung: Entziehung durch verbotene Eigenmacht und der Anspruchsgegner muss fehlerhaften Besitz haben.
Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 862 BGB): Bei Störung des unmittelbaren Besitzes durch verbotene Eigenmacht.
Voraussetzung: Störung durch verbotene Eigenmacht und der Anspruchsgegner ist der Störer.
Petitorischer Besitzschutz (§ 1007 BGB)
Der petitorische Schutz geht tiefer und fragt nach dem besseren Recht zum Besitz (im Kern §§ 985 ff. BGB, hier speziell § 1007 BGB). Er ist subsidiär zum possessorischen Schutz.
Grundprinzip: Schutz des früheren Besitzers gegenüber einem unredlichen (bösgläubigen) oder unberechtigten neuen Besitzer.
Herausgabeanspruch bei Bösgläubigkeit (§ 1007 Abs. 1 BGB):
Der frühere Besitzer kann vom neuen Besitzer die Herausgabe verlangen, wenn der neue Besitzer bei Besitzerwerb nicht gutgläubig war (er wusste oder hätte wissen müssen, dass er keinen Anspruch auf den Besitz hatte).
Herausgabeanspruch bei Abhandenkommen (§ 1007 Abs. 2 BGB):
Der frühere Besitzer kann die Herausgabe vom neuen Besitzer verlangen, wenn ihm die Sache abhandengekommen ist (z.B. gestohlen, verloren).
Ausnahmen: Der Anspruch besteht nicht, wenn der derzeitige Besitzer Eigentümer ist oder ihm die Sache ihrerseits früher abhandengekommen ist.
5.2 Eigentum an beweglichen Sachen
Abgrenzung Besitz und Eigentum
Merkmal | Besitz (Tatsächliche Herrschaft) | Eigentum (Rechtliche Herrschaft) |
Grundlage | Tatsächliche Sachherrschaft über die Sache (Wer hat die Sache gerade in der Hand oder unter seiner Kontrolle). | Umfassendes Herrschaftsrecht an der Sache (§ 903 BGB). |
Inhalt | Gewährt dem Besitzer grundsätzlich nicht die Rechte zur Veräußerung, Belastung oder Vermietung der Sache. | Gewährt dem Eigentümer das Recht, nach freiem Ermessen mit der Sache zu verfahren (veräußern, belasten, vermieten). |
Beziehung | Eigentümer und Besitzer können identisch sein (z.B. Eigentümer, der in seiner eigenen Wohnung lebt). Sie können aber auch verschieden sein (z.B. Mieter ist Besitzer, Vermieter ist Eigentümer). |
Inhalt, Umfang und Arten des Eigentums
Inhalt und Umfang des Eigentums
Das Eigentum ist das umfassendste Herrschaftsrecht an einer Sache (§ 903 BGB).
Rechte des Eigentümers: Der Eigentümer kann mit seiner Sache nach Belieben verfahren (nutzen, verändern, zerstören).
Grenzen des Eigentums: Dieses Recht ist nicht unbegrenzt. Es findet seine Schranken durch:
Das Gesetz (z.B. Bauvorschriften, Umweltauflagen).
Die Rechte Dritter (z.B. ein wirksamer Mietvertrag schränkt das Nutzungsrecht des Eigentümers ein). Dieser Grundgedanke leitet sich aus Art. 14 GG (Grundgesetz) ab.
Arten des Eigentums
Der Gesetzgeber unterscheidet verschiedene Formen, wie das Eigentum ausgestaltet sein kann:
Alleineigentum (§§ 903 ff. BGB): Eine einzelne Person ist Eigentümer der gesamten Sache.
Miteigentum (§§ 1008 ff. BGB): Mehrere Personen sind Eigentümer eines ideellen Anteils der Sache (z.B. ein Ehepaar, das gemeinsam ein Haus kauft).
Gesamthandseigentum: Das Eigentum gehört einer Gemeinschaft (Gesamthandsgemeinschaft), wie z.B. bei der BGB-Gesellschaft (§§ 705 ff. BGB) oder einer Erbengemeinschaft. Die einzelnen Mitglieder können nicht frei über ihren Anteil verfügen.
Wohnungseigentum (WEG): Eine Sonderform, bei der jemand Alleineigentum an einer bestimmten Wohnung in einem Gebäude hat und gleichzeitig Miteigentümer am Gemeinschaftseigentum (z.B. Treppenhaus, Dach) ist.
Schutz und Erwerb des Eigentums
Um dem Eigentümer sein umfassendes Herrschaftsrecht zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber Schutz- und Erwerbsgrundlagen geschaffen:
Herausgabeanspruch (§ 985 BGB): Der Eigentümer kann vom Besitzer die Herausgabe seiner Sache verlangen, wenn der Besitzer kein Recht zum Besitz hat. Dies ist die wichtigste Anspruchsgrundlage zur Durchsetzung des Rechts auf Besitz.
Erwerb des Eigentums: Die Übertragung des Eigentums an beweglichen Sachen ist in §§ 929 ff. BGB geregelt (z.B. durch Einigung und Übergabe).
Aufgabe des Eigentums (§ 959 BGB): Es steht dem Eigentümer frei, sein Eigentum durch Dereliktion (willentliche Besitzaufgabe) aufzugeben.
Voraussetzungen
1. Anspruchsinhaber ist Eigentümer:
Die Eigentümerstellung muss positiv festgestellt werden. In der Fallprüfung ist die "historische" Prüfung des Eigentumsverlaufs notwendig.
Als Hilfestellung kann die Vermutungsregelung des § 1006 Abs. 2 BGB herangezogen werden: Wer die Sache früher im unmittelbaren Besitz hatte, wird als Eigentümer vermutet.
2. Anspruchsgegner ist Besitzer:
Grundsätzlich ist jede Besitzform ausreichend (Eigen-, Fremd-, Allein-, Mit-, mittelbarer oder unmittelbarer Besitzer).
Ausnahme: Ein Besitzdiener kann nicht Anspruchsgegner sein, da er selbst kein Besitzer ist.
3. Herausgabegegenstand ist eine Sache:
Es muss sich um eine körperliche Sache im Sinne des § 90 BGB handeln. Nach § 90a Satz 3 BGB gilt dies auch für Tiere.
Der Anspruch richtet sich stets nur auf die ursprüngliche einzelne Sache (nicht auf Sachgesamtheiten oder Ersatzsachen).
Einwendungen des Besitzers (Recht zum Besitz, § 986 BGB)
Ein Anspruch aus § 985 BGB kann dauerhaft nur gegen einen unberechtigten Besitzer durchgesetzt werden.
Steht dem Besitzer ein Recht zum Besitz zu, kann er die Herausgabe gemäß § 986 BGB verweigern (dies ist eine Einwendung, die von Amts wegen zu berücksichtigen ist).
Der Besitzer hat ein Recht zum Besitz, wenn er:
Ein eigenes Recht hat (§ 986 Abs. 1 S. 1, 1. Alt. BGB): z.B. aus Miete, Pacht, Leihe, Kauf (schuldrechtlich) oder Nießbrauch (dinglich).
Ein abgeleitetes Recht hat (§ 986 Abs. 1 S. 1, 2. Alt. BGB): z.B. als Untermieter gegenüber dem Eigentümer.
Ein Besitzrecht gegenüber dem Rechtsnachfolger des Eigentümers hat (§ 986 Abs. 2 BGB).
Herausgabe des Anspruchs
Die Herausgabe erfolgt grundsätzlich durch Übertragung des unmittelbaren Besitzes. Dabei ist die jeweilige Besitzposition des Anspruchsgegners zu beachten.
Bei Immobilien (Wohnung, Gebäude, Grundstück) erfolgt die Herausgabe durch Räumung.
Der Ort der Herausgabe richtet sich nach § 269 BGB und erfolgt am Standort der Sache.
Ausschluss und Erlöschen des Anspruchs
Der Anspruch kann ausgeschlossen sein durch:
Treu und Glauben (§ 242 BGB).
Das Recht zum Besitz des Anspruchsgegners (§ 986 BGB).
Der Anspruch kann erloschen sein, wenn:
Er bereits erfüllt wurde.
Der Eigentümer seine Eigentumsstellung verloren hat.
Der Besitzer seinen Besitz verloren hat.
Verhältnis zu anderen Ansprüchen
Der Anspruch aus § 985 BGB besteht neben anderen gesetzlichen oder vertraglichen Herausgabeansprüchen (z.B. aus § 812 BGB oder § 823 BGB). Der Anspruchsinhaber kann die Anspruchsgrundlage wählen, die ihm am besten weiterhilft.
Eigentumserwerb durch Gesetz
Der Gesetzgeber regelt den Eigentumserwerb von Gesetzes wegen vor allem aus zwei Gründen:
Fehlendes Interesse des früheren Eigentümers: Der Besitzer soll Eigentum erhalten, wenn der ursprüngliche Eigentümer ersichtlich kein Interesse mehr an der Sache hat (z.B. bei der Ersitzung oder Aneignung).
Praktische Notwendigkeit: Bestimmte Tatsachen (z.B. untrennbare Verbindung, Vermischung) machen eine klare Regelung der Eigentumsverhältnisse erforderlich.
Wichtige Erwerbsformen nach dem BGB
1. Ersitzung (§937 BGB)
Voraussetzung: Jemand hat eine bewegliche Sache für zehn Jahre in Eigenbesitz (unmittelbar oder mittelbar) und war in dieser Zeit gutgläubig (→ er dachte, die Sache gehöre ihm).
Ziel: Schaffung von Rechtssicherheit bei langjährigem, unangefochtenem Besitz.
Beispiel: Mieter B dachte, die vom Vormieter A zurückgelassenen Lampen gehörten ihm; nach 10 Jahren ohne Herausgabeforderung wird B Eigentümer.
2. Verbindung und Vermischung
Diese Fälle regeln den Eigentumserwerb, wenn Sachen untrennbar zusammengefügt werden.
Art | Vorschrift | Was passiert? | Beispiel |
Verbindung mit einem Grundstück | $\S 946$ BGB | Bewegliche Sache wird wesentlicher Bestandteil des Grundstücks; Eigentümer des Grundstücks wird Alleineigentümer. | Baum von A wird auf Grundstück von B gepflanzt ($\rightarrow$ gehört B). |
Verbindung beweglicher Sachen | $\S 947$ BGB | Bewegliche Sache wird wesentlicher Bestandteil einer anderen beweglichen Sache; Eigentümer der Hauptsache wird Alleineigentümer. | Kiel von B wird in Boot von A eingebaut ($\rightarrow$ gehört A). |
Vermischung | $\S 948$ BGB | Bewegliche Sachen werden so vermischt, dass sie nicht mehr trennbar sind (z.B. Flüssigkeiten, Gase). | Es entsteht Miteigentum nach Bruchteilen (Ausnahme: eine Sache ist als Hauptsache anzusehen $\rightarrow$ Alleineigentum). |
3. Verarbeitung (§950 BGB)
Voraussetzung: Jemand stellt durch Verarbeitung oder Umbildung (z.B. Malen, Drucken) eine neue Sache her.
Wirkung: Der Hersteller erwirbt das Eigentum an der neuen Sache.
Einschränkung: Gilt nicht, wenn der Wert der Verarbeitung erheblich geringer ist als der Wert des verwendeten Materials.
4. Aneignung und Fund
Aneignung (§958 BGB): Erwerb von Eigentum an einer herrenlosen Sache (entweder nie im Eigentum gewesen oder vom Eigentümer aufgegeben, §959 BGB) durch Inbesitznahme in Eigenbesitz.
Fund (§973 BGB): Erwerb von Eigentum an einer besitzlosen, aber nicht herrenlosen Sache durch den Finder, wenn sechs Monate nach Fundanzeige niemand sein Eigentum geltend macht. (Gilt nur, wenn der Fundwert $ > 10,00 \text{ Euro}$.)
5. Erwerb von Erzeugnissen (§§953 ff. BGB)
Grundsatz: Bestandteile (§93 BGB) und Erzeugnisse (§99 BGB, z.B. Äpfel, Eier) gehören grundsätzlich dem Eigentümer der Muttersache.
Ausnahme (§954 BGB): Eine andere Person erwirbt Eigentum an den Erzeugnissen bei der Trennung, wenn sie aufgrund eines Rechts an der Muttersache befugt ist, sich diese anzueignen (z.B. der Nießbrauchberechtigte).
Ausgleich des Rechtsverlustes (§951 BGB)
Verliert der frühere Eigentümer sein Recht durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung (§§946−950 BGB), hat er einen Anspruch auf finanziellen Ausgleich gegen den neuen Eigentümer.
Dieser Ausgleich richtet sich nach den Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung (§§812 ff. BGB).
Eine Wiederherstellung des früheren Zustandes kann nicht verlangt werden.
📜 Sonderfall: Schuldurkunden (§952 BGB)
Bei Urkunden, die Forderungen verbriefen (z.B. Schuldschein, Hypothek, Sparbuch), folgt das Eigentum an der Urkunde (bewegliche Sache) der Berechtigung aus der Urkunde (Forderung).
Das bedeutet: Wer die Forderung innehat, ist auch Eigentümer der Urkunde.
Abtretung (§398 BGB) der Forderung ist zusätzlich nötig, um die Berechtigung zu übertragen.
Eigentumserwerb durch Hoheitsakt
Eigentum kann auch durch ein hoheitliches Handeln des Staates erworben werden, d.h., der Staat veranlasst den Erwerb in einem Hoheitsakt (Verwaltungsakt, Gerichtsentscheidung).
Zwangsversteigerung beweglicher Sachen: Der Eigentumserwerb durch den Zuschlag an den Höchstbietenden erfolgt nach §817 II Zivilprozessordnung (ZPO).
Ehescheidung: Die richterliche Zuweisung von Hausrat an einen Ehepartner führt zum Eigentumserwerb des Begünstigten.
er Eigentümer kann sein Eigentum auf verschiedene Weisen verlieren. Der Text konzentriert sich auf die Eigentumsaufgabe.
Verlust des Eigentums
Die Eigentumsaufgabe ist in §959 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt und wird auch Dereliktion genannt.
Voraussetzungen: Der Eigentümer verliert das Eigentum, wenn er in der Absicht, auf das Eigentum zu verzichten (Willenserklärung), den Besitz der Sache aufgibt (Realakt).
Folge: Die Sache wird herrenlos (lat. res nullius).
Wichtige Unterscheidung: Es muss klar zwischen der Besitzaufgabe (Realakt, keine Geschäftsfähigkeit erforderlich) und dem Verzicht auf das Eigentum (rechtsgeschäftliche Handlung, Geschäftsfähigkeit erforderlich) unterschieden werden.
Beispiel: Das Herausstellen von Sperrmüll ist ein gängiges Beispiel für die Eigentumsaufgabe, da der alte Eigentümer damit seinen Besitz aufgibt und gleichzeitig den Willen zum Ausdruck bringt, das Eigentum aufzugeben.
Aufbau des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)
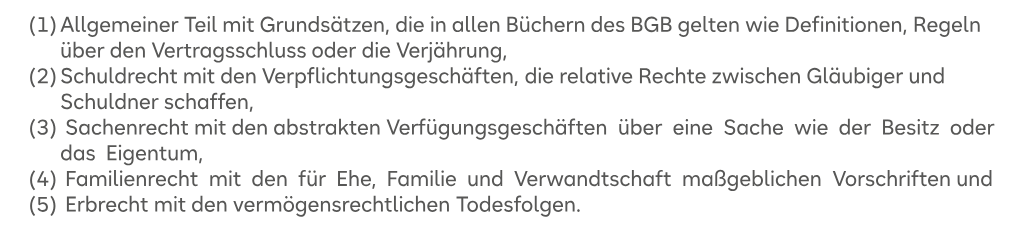
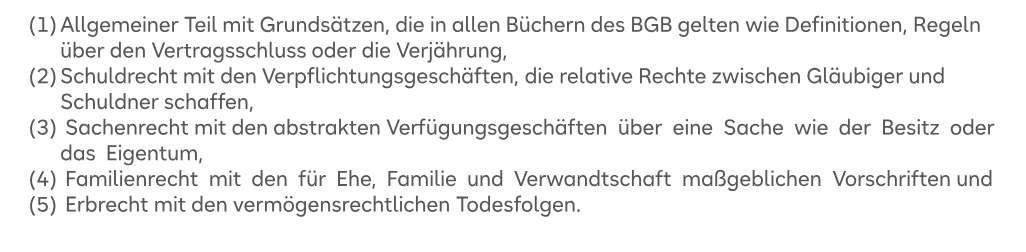
5 Grundprinzipien des Sachenrechts
Grundprinzipien: PASTA
Publizitätsgrundsatz: Dingliche Rechte sind nach außen erkennbar
Immobilien sind öffentlich einsehbar im Grundbuch. Mobilien jedoch nicht, daher nur Sachherrschaft (Besitz) erkennbar, nicht ob tatsächlich Eigentümer
Absolutheitsgrundsatz: Dingliche Rechte wirken gegenüber jedermann.
Rechte und Pflichten in Verträgen wirken nur zwischen den Vertragspartnern
Spezialitätsgrundsatz: Dingliche Rechte können nur an einzelnen Sachen bestehen.
Typenzwang: Das Sachenrecht kennt nur die gesetzlich geregelten Rechte
Abstraktionsprinzip: Trennung des dinglichen RG vom schuldrechtlichen RG.