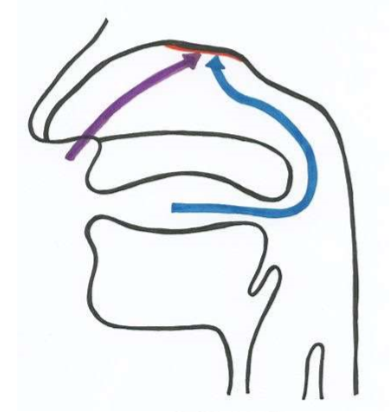Humanbio - Reichen und Schmecken
1/103
There's no tags or description
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |
|---|
No analytics yet
Send a link to your students to track their progress
104 Terms
Chemorezeption
Aufnahme von chemischen Reizen → können von allen Organismen wahrgenommen werden + für manche Organismen Hauptinformationsquelle
Chemische Signalgebung - Umwelt und Organismus
Chemische Reize, die z.B. zur Orientierung oder Gefahrenerkennung dienen
Chemische Signalgebung - innerhalb des Organismus
intraorganisch, Hormone
Chemische Signalgebung - Organismus und Organismus
interorganismisch, Semiochemikalien (gr. Semeon = Signal, Zeichen)
Chemische Signalgebung - interspezifisch
Allelochemikalien
Kairomone
Allomone
Synomone
Chemische Signalgebung - intraspezifisch
Duftmoleküle und Pheromone
Nutzen bei Kairomonen
für Empfänger
Nutzen bei Allomonen
für Sender
Allomone - Beispiele (2)
Lockstoffe → Attraktantien
Abwehrstoffe → Repellentien
→ Fleischfressende Pflanzen locken Insekten an
→ Spinne imitiert Sexuallockstoff um Beute anzulocken
Nutzen bei Synomonen
für Sender und Empfänger
Synomone - Beispiel
Blütenduft für Bestäuber
Nahsinn
Schmecken → Quelle muss im Mund/ in unmittelbarer Nähe sein
→ Stoffe müssen in Wasser gelöst sein -> an Geschmacksrezeptoren gelangen
Fernsinn
Riechen → Quelle kann weit weg sein -> sogar Kilometer weit weg
→ Wir nehmen flüchtige Stoffe aus der Luft oder aus dem Wasser wahr
Olfaktorisches Organ
= Riechepithel und Riechkolben
Riechkolben - latein
Bulbus olfactorius
Olfaktorisches Organ - Ablauf
1. Hirnnerv (Nervus olfactorius) -> Primäre Riechrinde (Teil des Telencephalon/ kleiner Bereich der Großhirnrinde) -> Wahrnehmung von Duftmolekülen
Vomeronasales Organ
= Jacobsons-Organ
Vomeronasales Organ - Ablauf
0. Hirnnerv (Nervus terminalis, Nervus vomeronasalis) -> akzessorischen Bulbus (Gebiet in der Nähe vom Riechkolben) -> limbisches System -> Wahrnehmung von Pheromonen
Hirnnerven - Abbildung
12 paarige Hirnnerven
Von vorne nach hinten durchgezählt (von rostral nach kaudal)
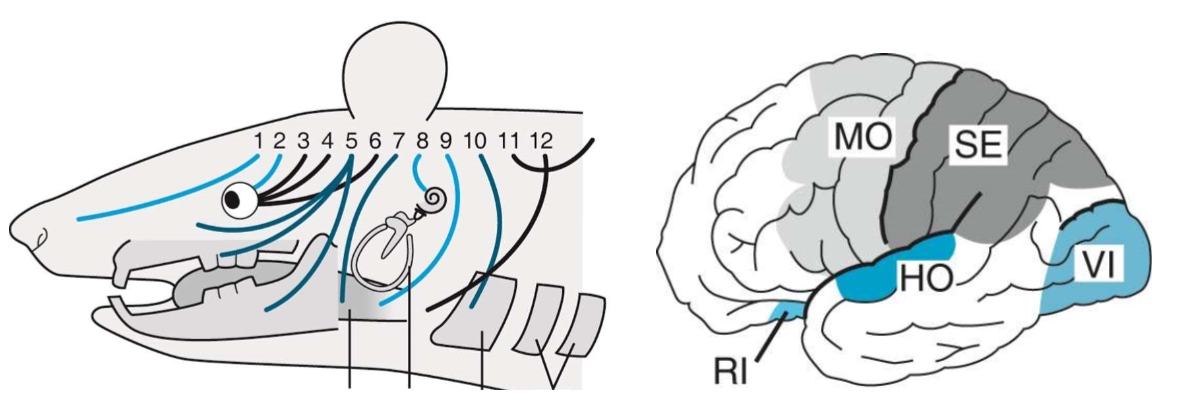
Hirnnerv
filigraner Hirnnerv, der lange übersehen wurde -> vor erstem Hirnnerv -> an Schädelbasis
Thalamus =
Tor zum Bewusstsein → welche sensorischen Informationen kommen in die Wahrnehmung → welche sind wichtig
Hirnnerv → vom Balbus zur Riechrinde - Verschaltung
Einzige sensorische Information (das Riechen), die nicht komplett über Thalamus verschaltet wird → Informationen direkt ins limbische System
Erneuerung von Riechzellen
Riechzellen sterben irgendwann ab !!!
Werden erneuert
Lebenslange Stammzellen -> nur wenige Zelltypen haben das
Bei Zellen des Hippocampus genauso
Gehirn - Abbildung
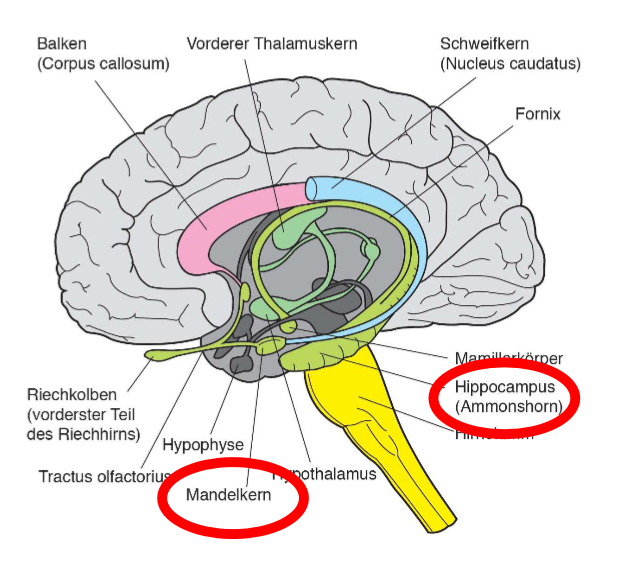
Limbisches System
Emotionen + Gedächtnis
Amygdala (Mandelkern)
im limbischen System → Emotionale Reaktionen auf verschiedene Reize
Hippocampus (Ammonshorn)
im limbischen System → Speicherung von Gedächtnisinhalten, Langzeitgedächtnis
Riechepithel - Größe
2 x 2,5 cm2
Riechepithel - Lage
oberste der drei Conchen
Auf oberster der drei Nasenmuscheln zu beiden Seiten der Nasenscheidewand
Unmittelbar unter Siebbeinplatte
Riechepithel - Zelltypen (4)
Stützzellen, Basalzellen, Riechsinneszellen, Mitralzellen
Riechzellen - Anzahl
ca. 30 Millionen
Riechzellen - Lebensdauer + Erneuerung
1 Monat + durch Basalzellen erneuert
Zilien
ragen in den Schleim
Am apikalen Ende der Riechsinneszellen
Lange Ausstülpungen der Zellmembran
primäre Sinneszellen
Sinneszellen mit eigenem Axon ohne nachgeschaltetes Neuron
Riechen - Abbildung
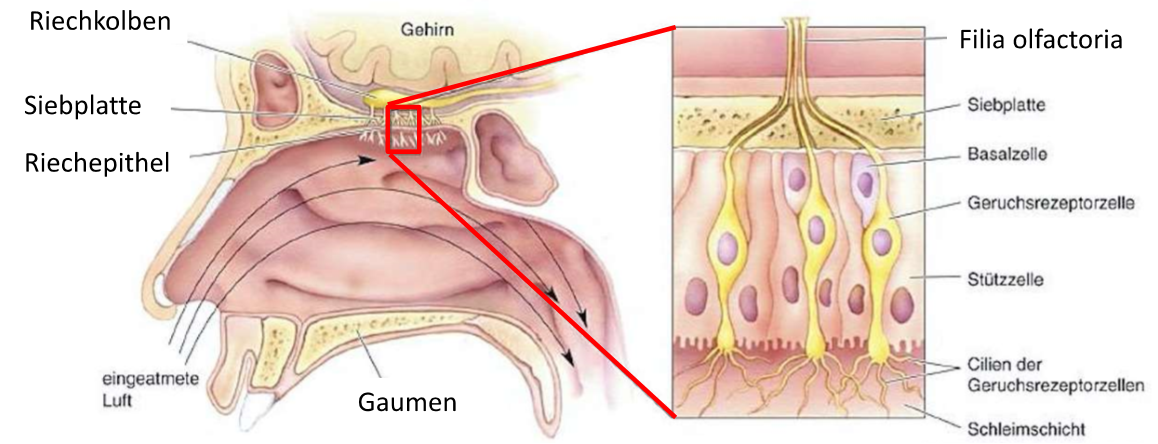
Siebbeinplatte
Teil des Schädels
Durchlöcherter Knochen
Axone von Riechsinneszellen führen dadurch -> zum Riechkolben
Riechen - Ablauf
Duftstoffe kommen an -> Aktionspotentiale werden ggf. ausgelöst -> Information zu Riechkolben -> Riechhirn
Riechschleimhaut - Zusammensetzung
Besteht aus verschiedenen Zellen
Riechsinneszelle/ Geruchsrezeptorzellen + Stützzellen + neue Riechsinneszellen aus Basalzellen
Zilien bis Riechkolben - Abbildung
Duftmoleküle docken an Zilien an
Axone ziehen durch Siebbeinplatte zur ersten synaptischen Verschaltung im Bulbus olfactorius
Membran der Zilien
In Membran -> Duftstoffrezeptoren
Jede Riechsinneszelle trägt nur einen Duftstoffrezeptortyp
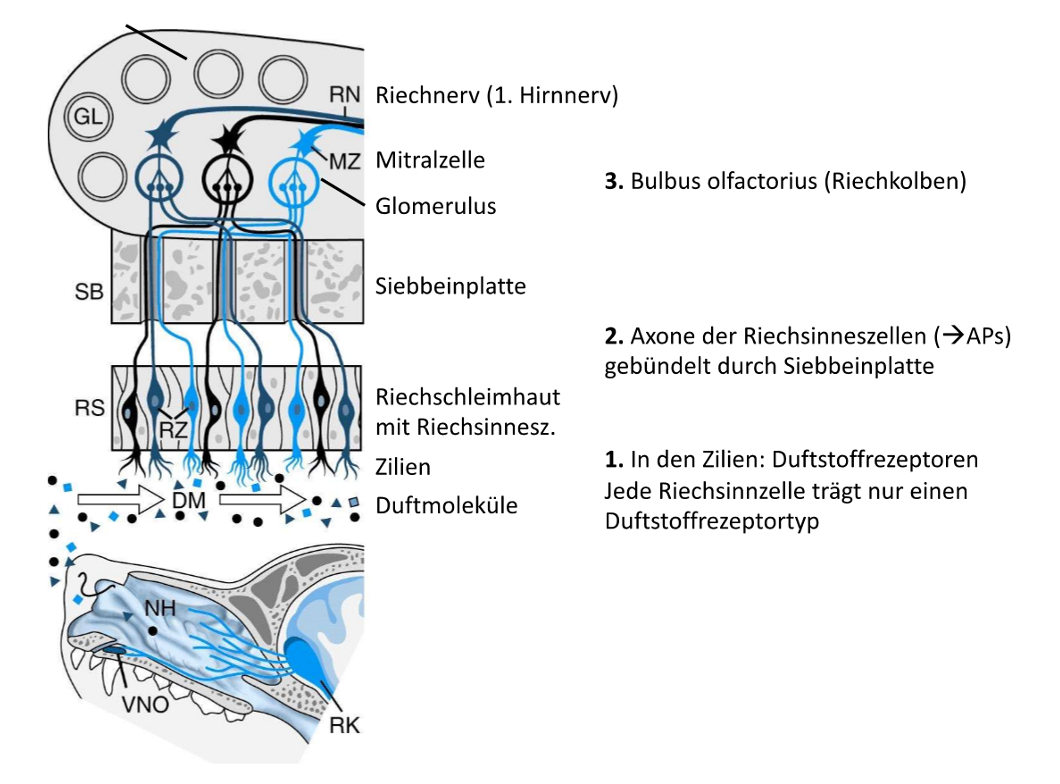
Transduktionsprozess - Ort
Transduktionsprozess in den Zilien der Riechsinneszellen
G-Protein gekoppelte Rezeptoren
Axone der Riechsinneszellen ziehen zum Bulbus olfactorius = Riechkolben
verschiedene Zellen - Abbildung
Bulbus olfactorius
Riechsinneszellen/ Duftstoffrezeptoren desselben Typs laufen im selben Glomerulus zusammen
Zellen werden jeden Monat erneuert von Basalzellen -> Basalzellen müssen richtige Ausläufer/ Axone in richtigen Glomerulus schicken
In jedem nur ein Typ von Riechsinneszellen
Basalzellen müssen sie richtig zuordnen
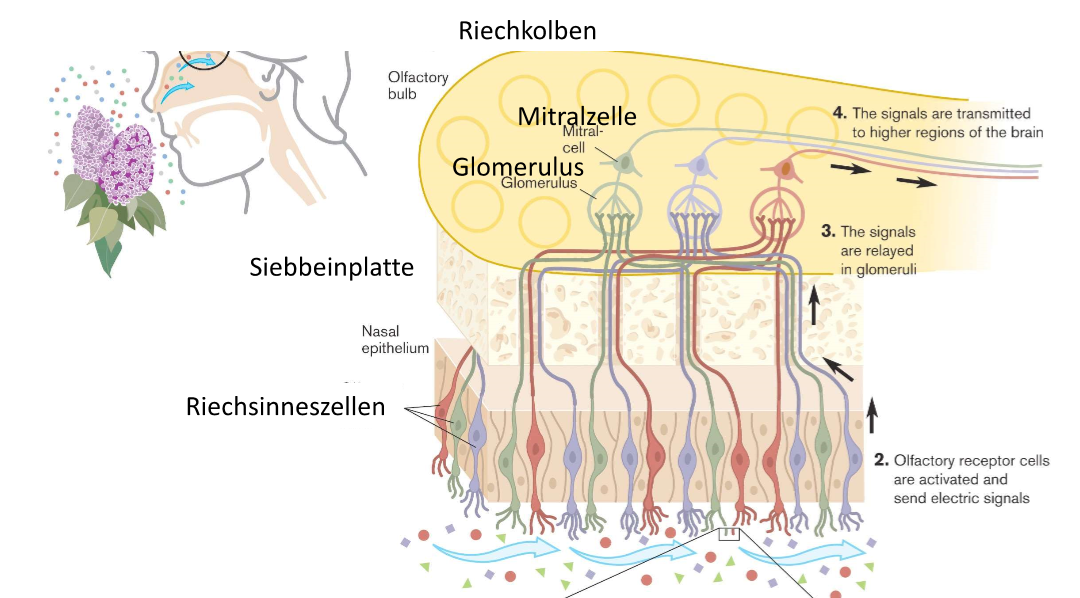
Glumerulus - Funktion
Synaptische Verbindungen mit Mitralzellen (einzige synaptische Schaltstelle auf dem Weg ins Gehirn)
Hohe Konvergenz: > 1.000 Axone von Riechsinneszellen projizieren auf eine Mitralzelle
Mitralzellen - Funktion
Einzige Umschaltstelle/ einziges anderes Neuron auf Weg zum Riechhirn
Schicken ihre Dendriten zum Glomerulus (Verschaltung mit Axonen -> synaptische Verbindung mit Riechsinneszellen -> über Riechnerv zum Gehirn)
30.000 Axone der Mitralzellen bilden den Riechnerv
Hemmung von benachbarten Neuronen
Periglomeruläre Zellen und Körnerzellen als Interneurone -> laterale Hemmung von benachbarten Neuronen bewirken
Hemmung von benachbarten Neuronen -> fokussieren auf einen bestimmten Geruch
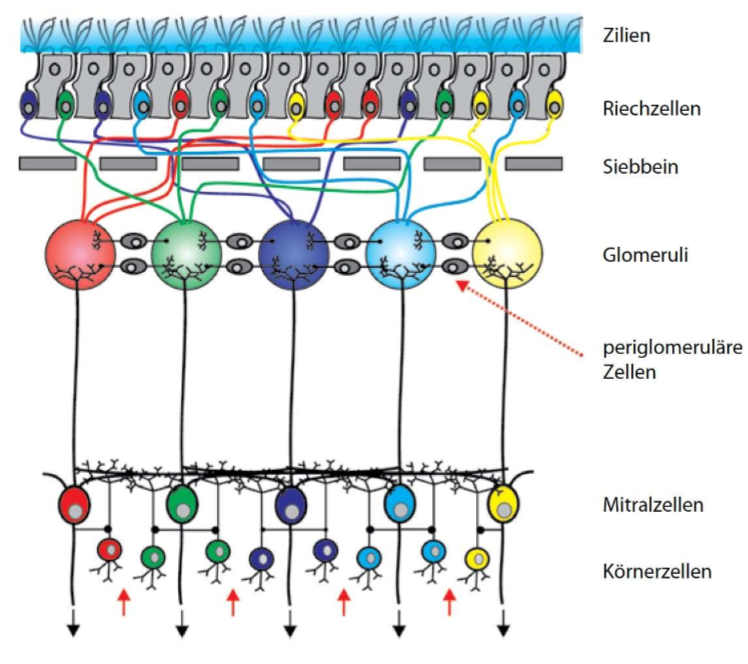
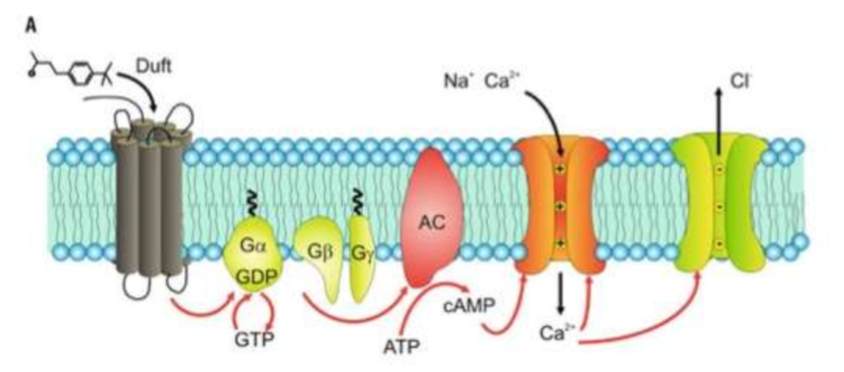
G-Protein gekoppelter Rezeptor
Von letzter Woche
cAMP : Cyklisches Adenosinmonophosphat
Calcium öffnet Kanal für Chloridionen
Wenige Duftmoleküle reichen für Reaktion aus
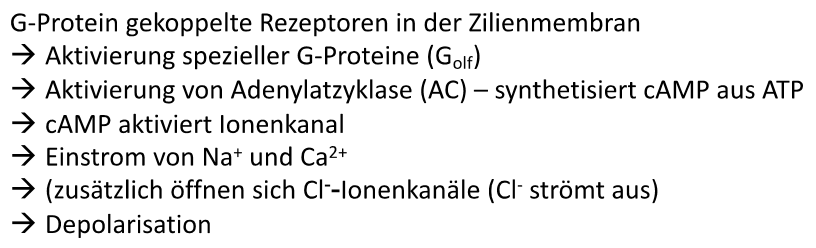
Geruchsrezeptoren + OR-Gene Mensch - Anzahl
380 Rezeptoren → 850 OR-Gene (olfactory receptor)
Expression der Gene
ändert sich je nach physiologischen Zustand → z.B. Ovulationszyklus, Schwangerschaft → Gerüche anders wahrnehmen
Wie kommen die Geruchsstoffe an die Geruchsrezeptoren?
= Odorant Binding Proteins
In Schleim der Nasenschleimhaut
Mikrosmaten
Geruchssinn ist schlecht ausgebildet und spielt eine untergeordnete Rolle
Makrosmaten
Geruchssinn ist gut ausgebildet uns spielt eine wichtige Rolle
Riechschleimhaut - Größe
ca. 5 cm2
Riechsinneszellen - Anzahl
ca. 30 Millionen
Riechzellen Hund - Anzahl
Dackel: ca. 125 Millionen Sinneszellen
Schäferhund: ca. 250 Millionen Sinneszellen. 150 cm2
Pheromone - Funktion
intraspezifische Kommunikation → Üben auf ein anderes Individuum (Empfänger) eine physiologische bzw. das Verhalten ändernde Wirkung aus
→ Modifizieren das Sozialverhalten und sind sozial modulierbar
Pheromone
Volatile (flüchtige) Substanzen, die von einem Individuum (Sender) gebildet und in die Umwelt freigesetzt werden
Pheromone bei niederen Wirbeltieren und Wirbellosen
Können nicht immer zwischen der intraspezifischen Kommunikation dienenden Duftstoffen und Pheromonen unterscheiden
Pheromone bei Säugetieren
Unbewusst über VNO (Vomeronasales Organ) rezipiert (akzessorisches Riechorgan)
Duftstoffe bei Säugetieren
Bewusst und unbewusst über das Riechepithel/ Riechkolben wahrgenommen (primäres Riechorgan)
Pheromone beim Menschen
Stoffe sind geruchslos aber haben eine Wirkung bei Menschen mit funktionierendem VNO
MHC
major histocampatibility complex
HLA → Name beim Menschen
humanes Leukozyten Antigen
Genetische Kompatibilitätshypothese
Wahl eines Paarungspartners mit komplementären Allelen (z.B. MHC)
Bessere immunologische Abwehr der Nachkommen
Je verschiedener → desto besser für die Nachkommen
Je verschiedener MHC-Moleküle sind, desto besser
wird von Pille beeinflusst
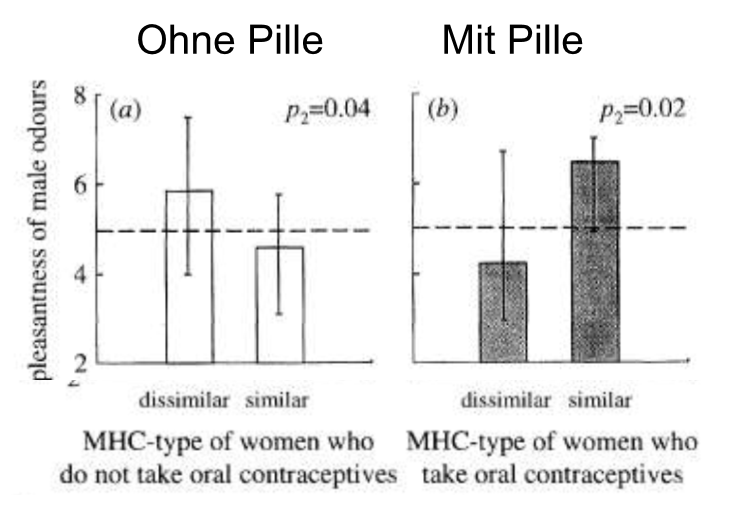
Geruchssinn - Erkennung von … (6)
Von Gefahren (z.B. Feuer)
Von Artgenossen
Eines Individuums (Individualgeruch)
Des Geschlechtspartners (Partnerwahl)
Des Verwandtschaftsgrads
Des sozialen Status
Geruchssinn - Funktion (6)
Erkennung von z.B. Gefahren
Finden von Nahrung
Lokalisieren von Nahrung
Heimfindevermögen
Navigation/ Orientierung
Reviermarkierung
Lokalisieren von Nahrung - Beispiel
Stereo-Riechen bei Hammerhai
Heimfindevermögen - Beispiele (2)
Aale und Lachse bei Wanderung
Navigation - Beispiel
Brieftauben
Pilzpapillen - Anzahl
200-400
Geschmacksknospen pro Pilzpapille
3-4 → über Zunge verteilt
Blätterpapillen - Anzahl
15-20
Geschmacksknospen pro Blätterpapille
ca. 50
Wallpapillen - Anzahl
7-12
Geschmacksknospen pro Wallpapille
100
Fadenpapillen - Funktion
nur taktile Funktion
Schmecken - Papillenarten (4)
Pilzpapillen
Blätterpapillen
Wallpapillen
Fadenpapillen
Papillen - Abbildung
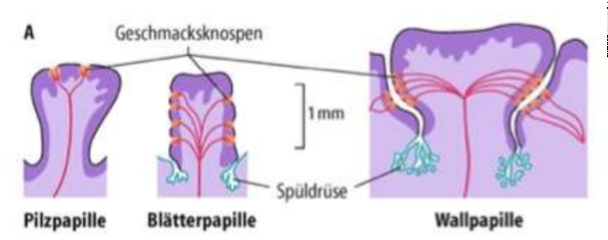
Geschmacksknospen bei jungen Menschen - Anzahl
ca. 9.000
Geschmacksknospen bei älterem Mensch - Anzahl
ca. 4.000
Geschmackssinneszellen pro Geschmacksknospe
ca. 50
Zunge - Abbildung
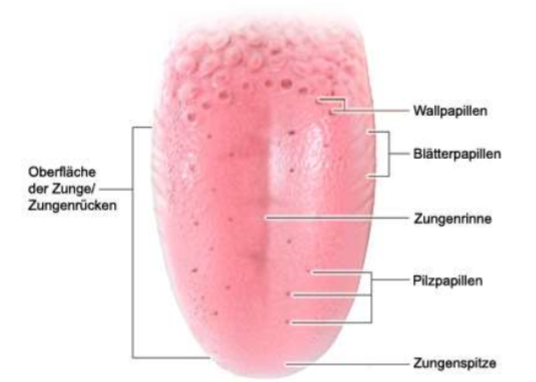
Geschmackssinneszelle - Abbildung
Mikrovilli am apikalen Ende
Geschmacksrezeptoren in der Membran der Mikrovilli
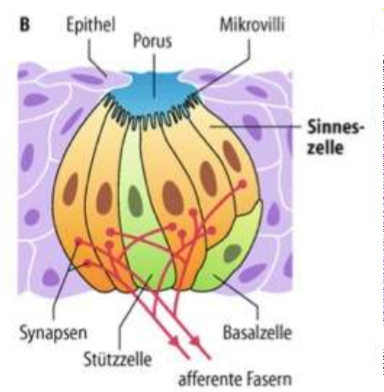
Geschmackszellen - Ursprung
aus modifizierten Epithelzellen
Geschmackszellen - Lebensdauer
10 Tage
sekundäre Sinneszellen - beteiligte Hirnnerven
Werden von drei Hirnnerven innerviert -> 7., 9., 10.
Geschmacksqualitäten (6)
süß
sauer
salzig
bitter
umami (herzhaft)
(fettig)
Geschmacksqualitäten Schmecken - Abbildung
sauer und salzig → Rezeptor ist gleichzeitig der Ionenkanal
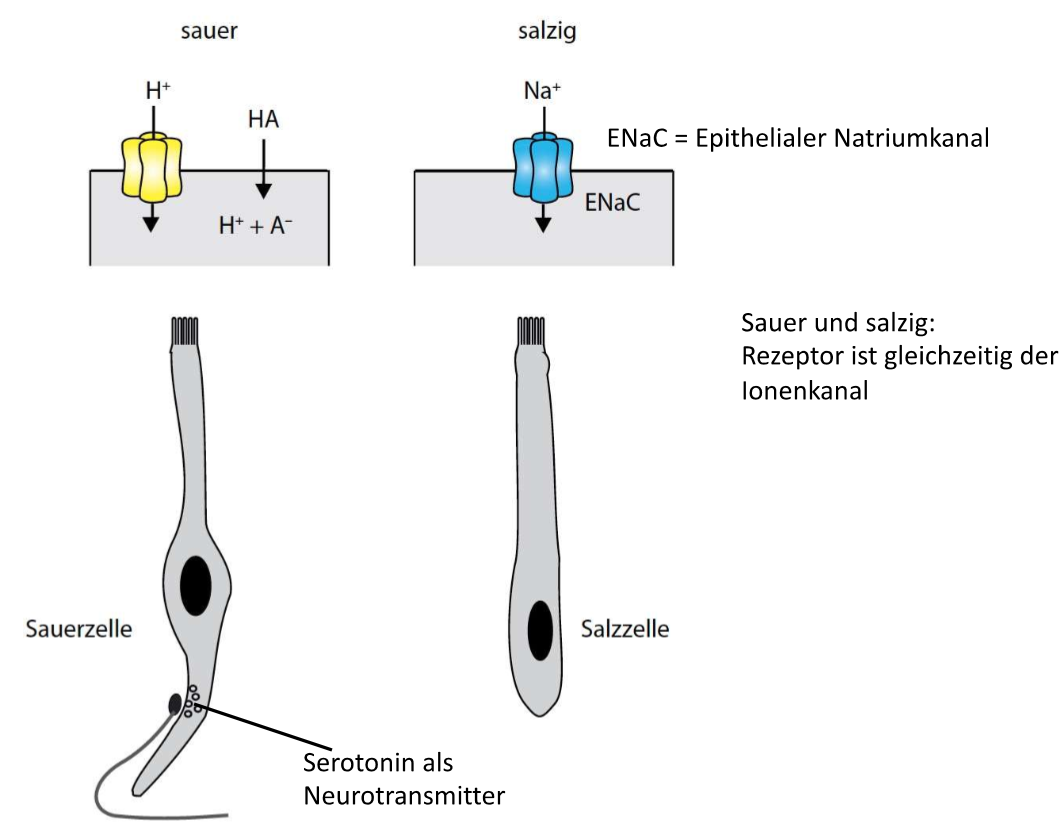
Bitter - beteiligter Rezeptor
T2Rx - taste receptor type 2
umami - beteiligter Rezeptor (2)
T1R1 und T1R3
süß - beteiligter Rezeptor (2)
T1R2 und T1R3
Ionenkanal (Natrium) für bitter, süß, umami
TRPM5
bitter - Anzahl verschiedener Rezeptoren als Monomere
25 (bei Mäusen 40)
Süß/ umami - Rezeptoren Besonderheit
Jeweils 2 Rezeptoren der T1R-Genfamilie bilden ein Dimer
G-Protein gekoppelter Rezeptor beim Schmecken
G-Protein aktiviert Phospholipase C -> ... -> Natriumeinstrom (Depolarisation)
Möglicherweise dient ATP als Transmitter zwischen Geschmackssinneszellen und Nervenfasern
Dimer
Rezeptoren arbeiten zusammen
Wenn beide ausgebildet sind kann man auf süß reagieren
Geschmackssinn Katzen
Allel T1R2 defekt -> können süß nicht schmecken
Allerdings T1R3 intakt -> wichtig für umami
spezieller Bitterrezeptor
TAS2R38
TAS2R38 - Bitterrezeptor
Reagiert spezifisch auf Phentylthiocerabimid (PTC)
3 Isoformen des TAS2R38-Gens
Manche empfinden PCT extrem bitter (PAV und AAI), andere schmecken es gar nicht (AVI)
Gastrophysik
Kombination aus Gastronomie und Psychophysik → Wie nehmen wir essen wahr?
Psychophysik
Wissenschaftliche Erforschung von Wahrnehmungen basierend auf Reaktionen, die in Folge von definierten Reizen auftreten
Beispiel: Akustik - Erstellen einer Hörschwellenkurve
Geschmackssinn
Vieles das von uns als Geschmack wahrgenommen wird, ist eigentlich riechen über den retronasalen Weg (blau)
Eigentliches Reichen über orthonasalen Weg (lila) an das Riechepithel