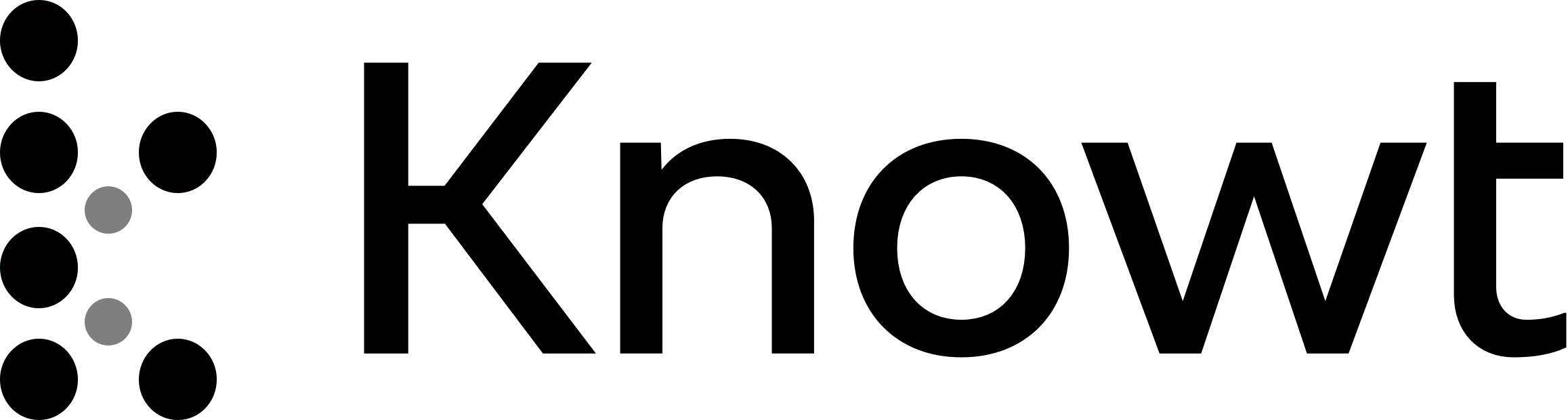Ethik Flashcards
Grundlagenbegriffe der Ethik
Ethik
Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Grundlagen des moralischen Handelns beschäftigt.
Fragen: Was soll ich tun? Wie soll ich leben? Was ist ein gutes Leben?
Kritische Reflexion über moralische Vorstellungen.
Ziel: Formulierung allgemeingültiger Prinzipien moralischen Handelns.
Teilgebiet der praktischen Philosophie.
Systematische Reflexion moralischer Prinzipien, Normen und Werte.
Ziel: Erarbeitung objektiver oder intersubjektiv gültiger Kriterien für moralisch richtiges Handeln.
Unterscheidung:
Deskriptive Ethik: Empirische Beschreibung moralischen Verhaltens.
Angewandte Ethik: Konkrete Anwendung ethischer Theorien auf Einzelfälle.
Zentrales Anliegen: Klären, unter welchen Bedingungen Handlungen als gut, gerecht oder richtig gelten können und wie Menschen miteinander umgehen sollten.
Moral
In einer Gesellschaft herrschende Normen und Werte, die als verbindlich gelten.
Zeigt, was Menschen als richtig oder falsch, gut oder böse empfinden.
Orientierung oft nach kulturellen, religiösen oder sozialen Konventionen.
Gelebte Praxis normativer Vorstellungen innerhalb einer bestimmten sozialen Gruppe oder Gesellschaft.
Umfasst Verhaltensregeln, Wertvorstellungen, Überzeugungen und Konventionen, die für ein moralisch gutes Leben als bindend angesehen werden.
Entstehung durch Erziehung, Tradition, Religion, Gesetze oder soziale Praktiken; Unterschiede von Gesellschaft zu Gesellschaft.
Die Ethik reflektiert kritisch über diese Moralvorstellungen und fragt nach ihrer Begründbarkeit und universellen Gültigkeit.
Normativität
Moralische Aussagen beanspruchen Gültigkeit – sie sagen, wie Menschen handeln sollen, nicht nur wie sie handeln.
Die Ethik prüft die Begründbarkeit solcher normativen Ansprüche.
Zentrales Merkmal moralischer Aussagen: Sie behaupten nicht nur, wie etwas ist, sondern sagen, wie etwas sein soll.
Unterscheidung von bloß deskriptiven Aussagen.
Deskriptiv: ‚Manche Menschen lügen.‘
Normativ: ‚Man soll nicht lügen.‘
Ethik als normative Theorie versucht, Regeln aufzustellen, die Handlungen bewerten können – unabhängig von individuellen Vorlieben oder gesellschaftlichen Konventionen.
Philosophen der Antike
Sokrates – Das sokratische Gespräch
Sokrates (470–399 v. Chr.) gilt als Begründer der ethischen Philosophie.
Keine eigenen Schriften; sein Denken ist durch die Dialoge Platons überliefert.
Zentrales Anliegen: ethisches Wissen klären und die Menschen zur Selbsterkenntnis führen.
Entwicklung des sokratischen Gesprächs – eine Methode, in der durch gezielte Fragen die Unwissenheit der Gesprächspartner aufgedeckt und gemeinsames Nachdenken angeregt wird.
Ziel: moralische Begriffe wie 'Gerechtigkeit', 'Tapferkeit' oder 'Frömmigkeit' zu präzisieren.
Beispiel: In Platons 'Apologie' konfrontiert Sokrates seine Mitbürger mit ihren vermeintlichen Kenntnissen über Tugend und entlarvt Widersprüche.
Kritik: Die Methode führt oft zu Aporien (Ratlosigkeit), ohne konkrete Antworten zu geben. Zudem kann sie überheblich oder destruktiv wirken.
Platon – Höhlengleichnis
Platon (427–347 v. Chr.), Schüler des Sokrates, entwickelte die Theorie der Ideen, nach der es eine unsichtbare Welt vollkommen reiner Formen gibt.
Das Höhlengleichnis (in 'Der Staat') beschreibt Menschen, die in einer Höhle gefesselt leben und nur Schatten an der Wand sehen – Sinnbild für das Leben in Unwissenheit.
Der Aufstieg eines Gefangenen ins Licht der Sonne steht für die Erkenntnis des Wahren, Guten und Schönen durch philosophisches Denken.
Das Gute ist für Platon die höchste Idee, vergleichbar mit der Sonne, die alles sichtbar macht.
Beispiel: Der Philosoph ist derjenige, der aus der Höhle steigt und das Licht (Wahrheit) erkennt – er trägt die Verantwortung, zurückzukehren und andere zu lehren.
Kritik: Platons Dualismus zwischen sinnlicher und intelligibler Welt wirkt abgehoben und realitätsfern. Die Idee des Philosophenkönigs ist autoritär.
Aristoteles – Mesoteslehre
Aristoteles (384–322 v. Chr.), Schüler Platons, entwickelte eine realistische Ethik auf Basis der menschlichen Natur.
Ziel des Lebens ist Eudaimonia – ein Zustand gelingender, tugendhafter Lebensführung im Einklang mit der Vernunft.
Tugendhaftigkeit entsteht durch Gewöhnung und Praxis, nicht durch angeborene Eigenschaften.
Die Mesoteslehre besagt, dass Tugenden in der Mitte zwischen zwei Extremen liegen (Übermaß und Mangel).
Beispiel: Die Tugend der Tapferkeit liegt zwischen Feigheit und Tollkühnheit.
Kritik: Die Lehre ist situationsabhängig und subjektiv. Unklar bleibt, wie die „rechte Mitte“ genau zu bestimmen ist.
Pflichtethik: Immanuel Kant
Kants Pflichtethik
Immanuel Kant (1724–1804) entwickelte eine Ethik, die unabhängig von Gefühlen, Konsequenzen oder äußeren Autoritäten sein sollte.
Für ihn ist allein der 'gute Wille' moralisch gut – dieser folgt der Pflicht, das moralische Gesetz aus Achtung zu befolgen.
Moralisches Handeln muss aus Pflicht geschehen, nicht aus Neigung, Nutzen oder Gefühlen.
Zentral ist der kategorische Imperativ, der als Prüfstein moralischer Handlungen dient.
Naturgesetzformel
Formulierung: 'Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.'
Maximen, die man nicht verallgemeinern kann (z. B. Lügen), sind unmoralisch.
Beispiel: Wenn jeder lügen dürfte, wäre Kommunikation sinnlos. Lügen widerspricht daher der Vernunft und ist unmoralisch.
Menschheitszweckformel
Formulierung: 'Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.'
Jeder Mensch hat einen inneren Wert (Würde) und darf nicht instrumentalisiert werden.
Beispiel: Ausnutzung eines Arbeitnehmers rein zur Profitsteigerung verletzt seine Menschenwürde.
Kritik an Kant
Kants Ethik gilt als formalistisch, emotionslos und starr.
Sie erlaubt keine Ausnahmen – selbst Notlügen sind verboten.
Moralisches Handeln allein aus Pflicht kann kalt und unmenschlich wirken.
Es fehlt Berücksichtigung konkreter Situationen oder Mitgefühl.
Utilitarismus
Klassischer Utilitarismus – Bentham
Jeremy Bentham (1748–1832) entwickelte den Utilitarismus als konsequenzialistische Ethik: Der moralische Wert einer Handlung hängt allein von ihren Folgen ab.
Das Ziel ist das größte Glück für die größte Zahl – dabei zählt Lust (Freude) als einziges Gut, Schmerz als einziges Übel.
Er schlägt ein hedonistisches Kalkül vor: Intensität, Dauer, Sicherheit, Nähe, Fruchtbarkeit und Reinheit von Lust werden berechnet.
Beispiel: Eine Maßnahme, die 100 Menschen Freude bringt, ist besser als eine, die nur einem nützt – selbst wenn einige darunter leiden.
Kritik: Reduktion komplexer moralischer Fragen auf Nutzenmaximierung. Glück ist nicht objektiv messbar, Rechte von Minderheiten bleiben unberücksichtigt.
Qualitativer Utilitarismus – Mill
John Stuart Mill (1806–1873) unterscheidet zwischen höheren (geistigen) und niederen (körperlichen) Freuden.
Ein unglücklicher Mensch, der edle Freuden kennt, ist besser dran als ein zufriedenes Tier ohne höhere Fähigkeiten.
Beispiel: Philosophisches Nachdenken ist wertvoller als bloßer Genuss durch Essen.
Kritik: Die Unterscheidung wirkt elitär. Wer entscheidet, was 'höher' ist?
Handlungs- und Regelutilitarismus
Handlungsutilitarismus beurteilt jede einzelne Handlung nach ihren konkreten Folgen.
Regelutilitarismus fragt, ob die Einhaltung einer Regel langfristig nützlicher ist als ihr Bruch.
Beispiel: Lügen kann im Einzelfall richtig sein (Handlung), aber eine allgemeine Regel gegen Lügen erzeugt mehr Vertrauen (Regel).
Kritik: Regeln können zu starr sein. Im Einzelfall ist Regelbruch manchmal moralisch geboten.
Präferenzutilitarismus – Peter Singer
Peter Singer (geb. 1946) entwickelt eine Form des Utilitarismus, in der nicht Lust, sondern die Erfüllung von Interessen entscheidend ist.
Jedes Wesen mit Präferenzen (auch Tiere, Babys, Kranke) ist moralisch zu berücksichtigen.
Beispiel: Tierleid zählt moralisch, weil Tiere Schmerz empfinden und Interessen haben.
Kritik: Präferenzen können irrational, widersprüchlich oder schwer zu erfassen sein. Interessenskonflikte sind schwer lösbar.
Schopenhauer – Mitleidsethik
Schopenhauer – Mitleidsethik
Arthur Schopenhauer (1788–1860) kritisiert rationalistische Moralsysteme und stellt das Mitleid ins Zentrum der Ethik.
Mitleid ist die unmittelbare, emotionale Teilnahme am Leid anderer – es führt dazu, egoistische Interessen zu überwinden.
Echte Moral beruht nicht auf Vernunft oder göttlichem Gebot, sondern auf der Fähigkeit, sich in andere einzufühlen.
Beispiel: Man hilft einem Armen, nicht weil es ein Gebot ist, sondern weil man sein Leid fühlt.
Kritik: Gefühle sind unzuverlässig, inkonsequent und nicht immer moralisch. Eine auf Mitleid gegründete Ethik ist schwer rational begründbar.